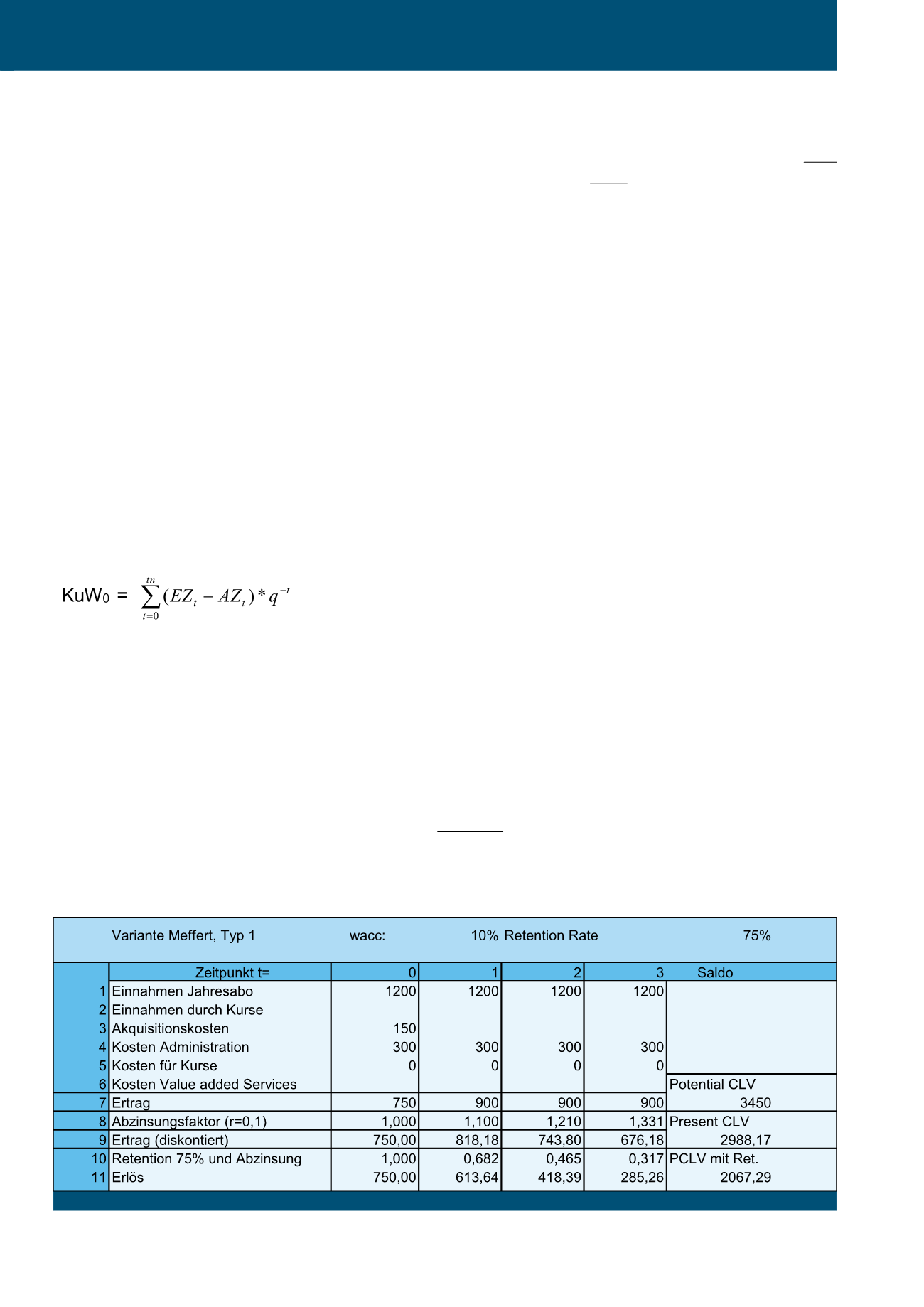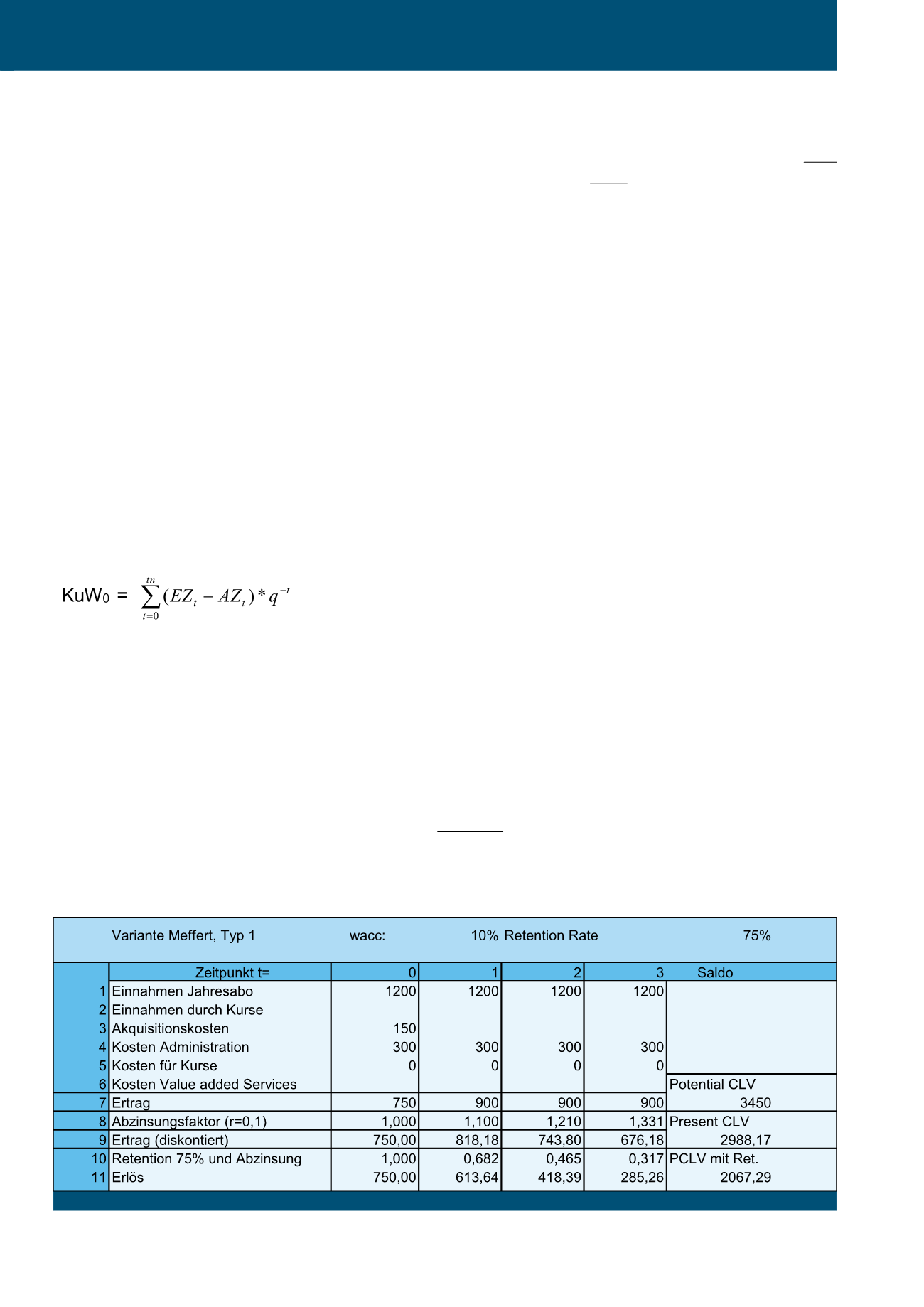
69
Zweck der Wirtschaftlichkeitskontrolle und
Verhaltensbeeinflussung erfüllt werden. Der
Wert der aktuellen Periode b) hilft bei der Ent-
deckung von Problemen, währenddessen der
zukünftige (prospektive) Kundenwert c) der
Entscheidungsunterstützung dient.
Unter Kundenwert (Value of the Customer) wird
die Summe aller auf einen einheitlichen Zeit-
punkt bezogenen Beiträge, die durch und für
den Kunden ausgelöst wurden, verstanden. Da-
bei stehen die monetarisierbaren Beiträge im
Vordergrund. Die Erwähnung des einheitlichen
Vergleichszeitpunkts ist wichtig, weil ansonsten
die einzelnen Beiträge nicht saldiert werden
dürfen. Besonders relevant aus Entscheidungs-
sicht ist der zukünftige Kundenwert, der die
Summe aller zukünftigen, monetarisierten und
auf den heutigen Zeitpunkt abgezinsten Beiträ-
ge darstellt, die durch und für den Kunden ver-
ursacht werden. Formelmäßig stellt sich der
prospektive Kundenwert wie folgt dar:
KuW
0
: Kundenwert (finanzieller Teil) zum
Zeitpunkt t=0
EZ
t
: Erwartete Einzahlungen vom Kunden
im Zeitpunkt t
AZ
t
: Erwartete Auszahlungen für den
Kunden im Zeitpunkt t
t:
Zeitindex mit t = 0, ..., tn
tn:
Letztes Element im Zeitindex t
q:
Zinsfaktor (1+i), mit i als Perioden-zinssatz (wacc)
Die Ein- und Auszahlungen beziehen sich je-
weils auf das Ende einer Periode. Da in der Re-
alität die Zahlungen über das Jahr verteilt an-
fallen, setzen die Jahresendgrößen voraus,
dass in einem vorgelagerten Schritt alle Zah-
lungen durch Verzinsung auf die jeweiligen Pe-
riodenenden bezogen wurden (intraperiodische
Verzinsung). Dies wird weiter unten am Beispiel
demonstriert. Im Weiteren ist zu unterscheiden,
ob die Kalkulation für einen
·
·
Bestandskunden,
·
·
einen potentiellen Neukunden oder für einen
·
·
Ex-Kunden
durchgeführt werden soll. Dazu sind bei den
Bestandskunden noch Intensivierungsstrategi-
en denkbar, mit denen höhere Einzahlungs-
überschüsse generiert werden müssen. Für ei-
nen Bestandskunden sind ansonsten die Akqui-
sitionsauszahlungen nicht mehr relevant. Es
handelt sich dann um Sunk Cost, die nicht
mehr beeinflussbar sind (vgl. dazu Hoberg
(2018b)). Damit wird die relevante Kalkulation
um die Anfangsauszahlungen entlastet, so
dass diese Kundengruppe c. p. günstiger wird.
Analyse des Beispiels
Meffert/Bruhn/Hadwich (2018) bringen auf S.
491 ff. ein Beispiel aus einem Fitnessstudio zur
Ermittlung des mehrperiodigen Kundenwertes
für 3 verschiedene Kundengruppen. Dabei wird
berücksichtigt, wie viel Prozent der Kunden von
Jahr zu Jahr treu bleiben (Retention Rate: beim
ersten Kundentyp in Abbildung 1: 75%). Die
erste Kundengruppe wählt nur das Stan-
dardangebot des Fitnessstudios, die zweite
einige Kurse plus einige Sonderleistungen und
die dritte Gruppe viele Kurse und viele Sonder-
leistungen. Die Kalkulation für die erste Kun-
dengruppe geben die Autoren, wie in Abbil-
dung 1 dargestellt, an:
Die Daten beziehen sich jeweils auf den durch-
schnittlichen Kunden des jeweiligen Typs. Es ist
zu ergänzen, dass die Daten somit in € pro
Durchschnittskunden gemessen werden, wobei
der notwendige Zeitbezug weiter unten abgelei-
tet wird. Zu den Daten wurden die Zeilennum-
mern ergänzt, um die Orientierung zu erleich-
tern. Zudem wurde der Rundungsfehler beim
Present CLV beseitigt. Alle anderen Elemente
entsprechen dem Original. Die Fehler werden
im Folgenden aufgezeigt und durch Verbesse-
rungen korrigiert, so dass der Leser sie nicht
noch einmal begehen muss.
Fehler in den Begriffen
Die Autoren schreiben zu Recht, dass mehrpe-
riodige Kalkulationen üblicherweise auf der Ba-
sis von Zahlungen durchgeführt werden (S.
490). Diese vernünftige Vorentscheidung ist
wichtig, weil Zahlungen zeitpunktorientiert er-
fasst werden müssen, während Erlöse und
Kosten periodenorientiert analysiert werden,
wobei dann die Periodenmitte den zeitlichen
Bezugszeitpunkt darstellt (vgl. zu diesen Zeit-
annahmen Hoberg (2004), S. 271 ff.). Auf kei-
nen Fall dürfen Zahlungen einerseits und Erlö-
se/Kosten bzw. Einnahmen/Ausgaben anderer-
seits saldiert werden, was aber im Beispiel an
vielen Stellen geschieht. Es fängt bei der ers-
ten Größe an, welche als „Einnahmen“ bezeich-
net werden. Relevant sind aber nur Zahlungen.
Abb. 1: Kundenwertbestimmung für Typ 1 nach Meffert/Bruhn/Hadwich, S. 491
CM Januar / Februar 2019