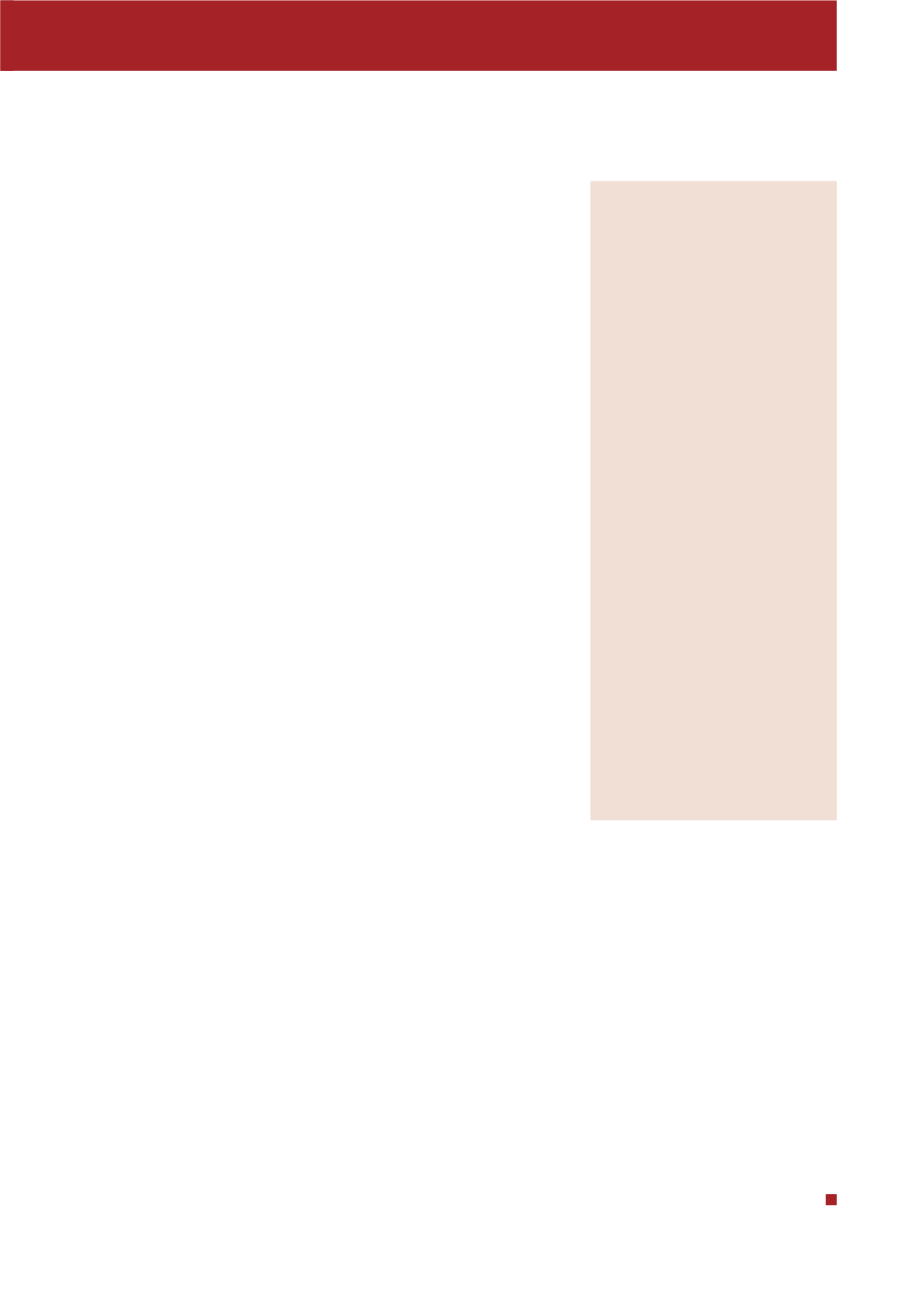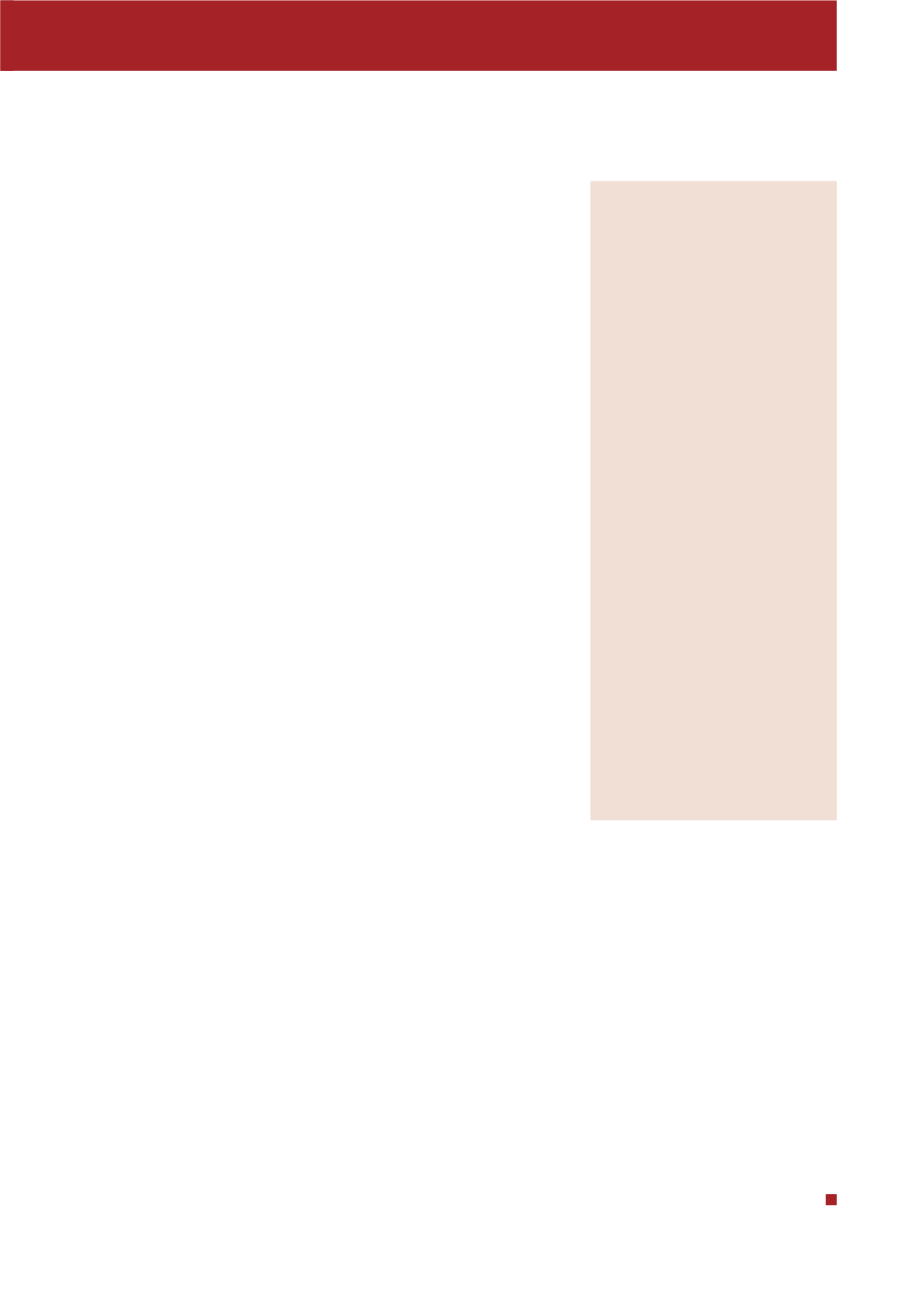
57
Zum Schluss (Märtin, S. 166)
Prüfen Sie Ihren Bericht nach folgenden Ebenen:
·
Inhaltcheck: Stimmt die Aussage? Sind
alle Fakten enthalten? Wurde die Kern-
botschaft deutlich gemacht? Wurde alles
verständlich erklärt? Wurde der Proporz
beachtet?
·
Logikcheck: Gibt es Gedankensprünge?
Sind Absätze richtig gesetzt? Bauen In-
formationen aufeinander auf? Steht die
Kernaussage am Anfang?
·
Optikcheck: Ist die Textlänge der Wertig-
keit des Themas entsprechend? Ist der
Text ausreichend strukturiert? Sind genü-
gend Auflockerungen eingebaut (Reiz-
worte, Absätze, etc.)? Können Tabellen
oder Diagramme verwandt werden?
·
Stilcheck: Wurde eine adäquate Sprache
genutzt? Liest sich der Text gut? Wurden
Schachtelsätze gebildet oder Verneinun-
gen eingebaut? Wurde substantiviert
statt Verben zu nutzen? Passen die Satz-
zeichen?
·
Lesercheck: Wird der Leser den komplet-
ten Text lesen? Wird die Spannung gehal-
ten? Wird des Lesers Sprache genutzt?
·
Holen Sie sich Feedback: Suchen Sie sich
einen Probeleser! Nehmen Sie die Kritik
ohne Entschuldigungen oder Gegenargu-
mentation an. Verteidigen Sie ihren Text
nicht. Nehmen Sie die Kritik an und ver-
bessern Sie ihn!
Literatur
Controlling wiki:
de/index.php/Berichtsprinzip_des_Controllers,
abgerufen am 02.10.2014
Gottschling: Stefan Gottschling, „Einfach bes-
ser texten“, Offenbach, 2010
Karrierehandbuch: Roger Fisher, „Das große
Karrierehandbuch, Frankfurt am Main, 2008
Märtin: Doris Märtin, „Erfolgreich texten“,
Frankfurt am Main, 2010
Muschitz: Michaela Muschitz, „Klartext
schreiben im Business“, Offenbach, 2010
PocketPower: Markus Reiter, Steffen Som-
mer, „Perfekt Schreiben“, München, 2013
Schlote: Axel Schlote, „Treffsicher texten“,
Weinheim, 2007
Runden
Sie Zahlen! Ein Viertel ist verständ-
licher als 24,38 Prozent. Sie erklären einem
Achtjährigen ja auch nicht das Gewicht eines
IPhones mit „genau 112 Gramm“, sondern „un-
gefähr so viel wie dein Hamster wiegt“.
Zahlen und kommentierender Text
gehören
in Sichtweite. Tun Sie dies nicht, zwingen Sie
den Leser zum Blättern. Die Motivation zum Le-
sen des gesamten Berichtes steigert dies
kaum. Machen Sie Ihren Bericht benutzer-
freundlich! Ebenfalls vorsichtig sollten
Anga-
ben in Klammern
getätigt werden. Ein voll-
ständiger Satz ist meist einfacher zu lesen.
Vermeiden Sie Seekrankheit beim Leser durch
Strukturierung
! Das Leserauge und sein Hirn
brauchen Orientierung. Verwenden Sie Absät-
ze (Märtin: S. 125, 3-7 Zeilen), Infoboxen,
Spitzmarken (das sind kursiv oder fett ge-
druckt gesetzte Worte) (Märtin, S. 79) oder
Gedankenstriche (Märtin, S. 159)! Zur Nen-
nung vieler zusammengehöriger Daten bieten
sich Tabellen und Diagramme an. Bei Aufzäh-
lungen auch ruhig mal einen Doppelpunkt set-
zen, wenn es unbedingt in Textform sein muss
(Schlote, S.80).
Überschriften
sind ein zwingendes Gestal-
tungsmittel. Nur mit dem Lesen der Überschrif-
ten sollte der Leser die
Kernthemen
Ihres Be-
richtes erfassen. Zur Auffrischung von langen
Textpassagen bauen Sie gern
Reizworte
ein.
Beim überfliegen Ihres Textes wird der Leser
hier (wieder) anfangen zu lesen.
Da Kommentieren ein Kampf um die Aufmerk-
samkeit für ein trockenes Thema ist,
variie-
ren sie
bitte mit
Stilmitteln
. Unterbrechen
Sie Ihre Theorieausführungen mit einem Pra-
xisbezug (z. B. konkrete Maßnahmen). Auflis-
tungen können Sie mit der Ankündigung:
„Drei Gründe möchte ich hierzu nennen …“
(Märtin, S. 126) beginnen. Ebenso bietet sich
die rhetorische Frage an z. B. „Welche Gründe
führten zu dieser Entwicklung?“ Diese rhetori-
schen Fragen aber nur sporadisch einbauen.
Sie sollen ja mit dem Controllingbericht nicht
Fragen, sondern Antworten liefern (Märtin,
S. 159). Wichtig ist es die Spannung zu hal-
ten. Fragen Sie sich beim Schreiben: Weshalb
sollte der Leser weiterlesen? Was wird sein
Benefit sein?
nen Text. Wenn Sie alle Zahlen mit „T€“ ange-
geben haben, dann sollten Sie auf die Angabe
von „Mio.€“ im Text verzichten.
Nutzen Sie ruhig
Wiederholungen
! Machen
Sie sich doch mal den Spaß und zählen Sie die
Wiederholungen in Werbespots. Da wird in 30
Sekunden dem potentiellen Kunden die Bot-
schaft förmlich eingehämmert. Aber Vorsicht!
Verwenden Sie
keine Synonyme
! Verwenden
Sie z. B. für ein neues Produkt ständig neue Be-
zeichnungen, so glaubt der Leser zum Schluss
an eine Produktoffensive.
Orientieren
Sie sich bei der
Wortwahl am Le-
ser!
Der Köder muss dem Fisch und nicht dem
Angler schmecken. Holen Sie Ihre Leser in de-
ren Lebenswirklichkeit ab. Sind z. B. in Ihrer
Branche Anglizismen alltäglich, so nutzen Sie
diese. Bei einem traditionellen Mittelständler
wird dies meist deplatziert wirken. In öffentli-
chen Unternehmen arbeiten oft harmoniebe-
dürftige Menschen. Hier gilt es die Wirkung des
Textes und der Worte zu achten.
Diplomatie
ist
gefragt.
Textdesign
Schachtelsätze
? Vergessen Sie es! Dies wirkt
inkompetent
. Es müssen nicht alle Informatio-
nen zu einem Thema in einem Satz stehen. Eine
Aussage pro Satz reicht (Schlote, S. 77). Bauen
Sie kurze Sätze mit einfachem Satzbau! Also im
Hauptsatz die Aussage und dahinter (nicht da-
zwischen) der Nebensatz (wenn überhaupt).
(Schlote, S. 80). Prüfen Sie Ihren Text, ob Sie
„und“ oder „sowie“ genutzt haben! Meist kön-
nen Sie den Satz dort teilen. Goldene Regel:
Wenn Ihnen beim Lesen Ihres eigenen Satzes
zwischendurch die Luft ausgeht, ist der Satz
eindeutig zu lang (PocketPower, S. 111). Bringen
Sie die
Kernaussage von komplizierten Sach-
verhalten am Anfang
(Märtin S. 116)! Falls
dann doch ein Schachtelsatz gebildet werden
muss, weiß der Leser schon mal worum es geht.
Bitte intellektuell anmutende
Verneinungen
streichen! Spätestens bei der doppelten Vernei-
nung muss der Leser die Textpassage wieder-
holen. Er wird sich vergewissern wollen, dass er
es korrekt verstanden hat. Dies hält aber nur
unnötig auf (Märtin, S. 117)
CM September / Oktober 2015