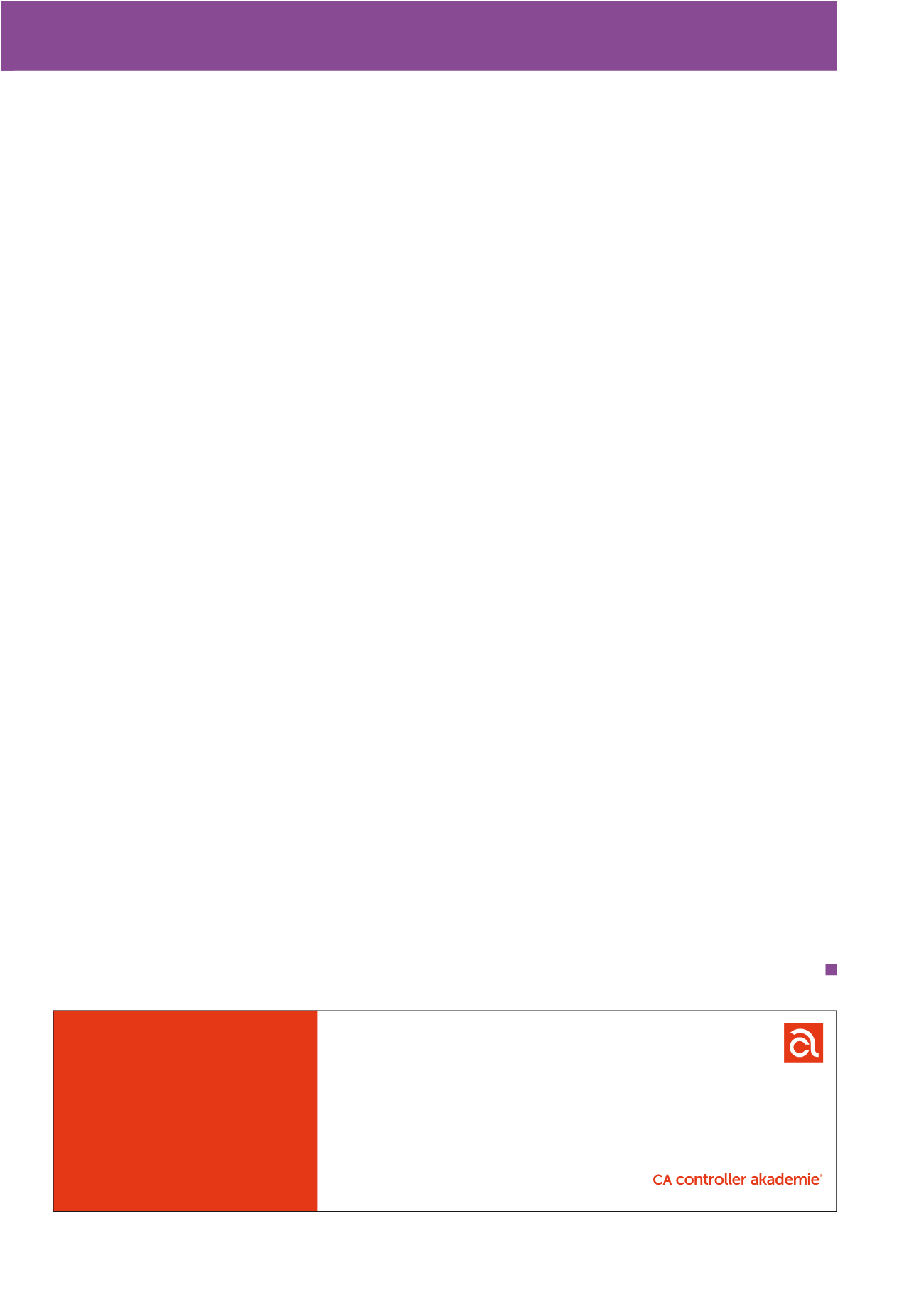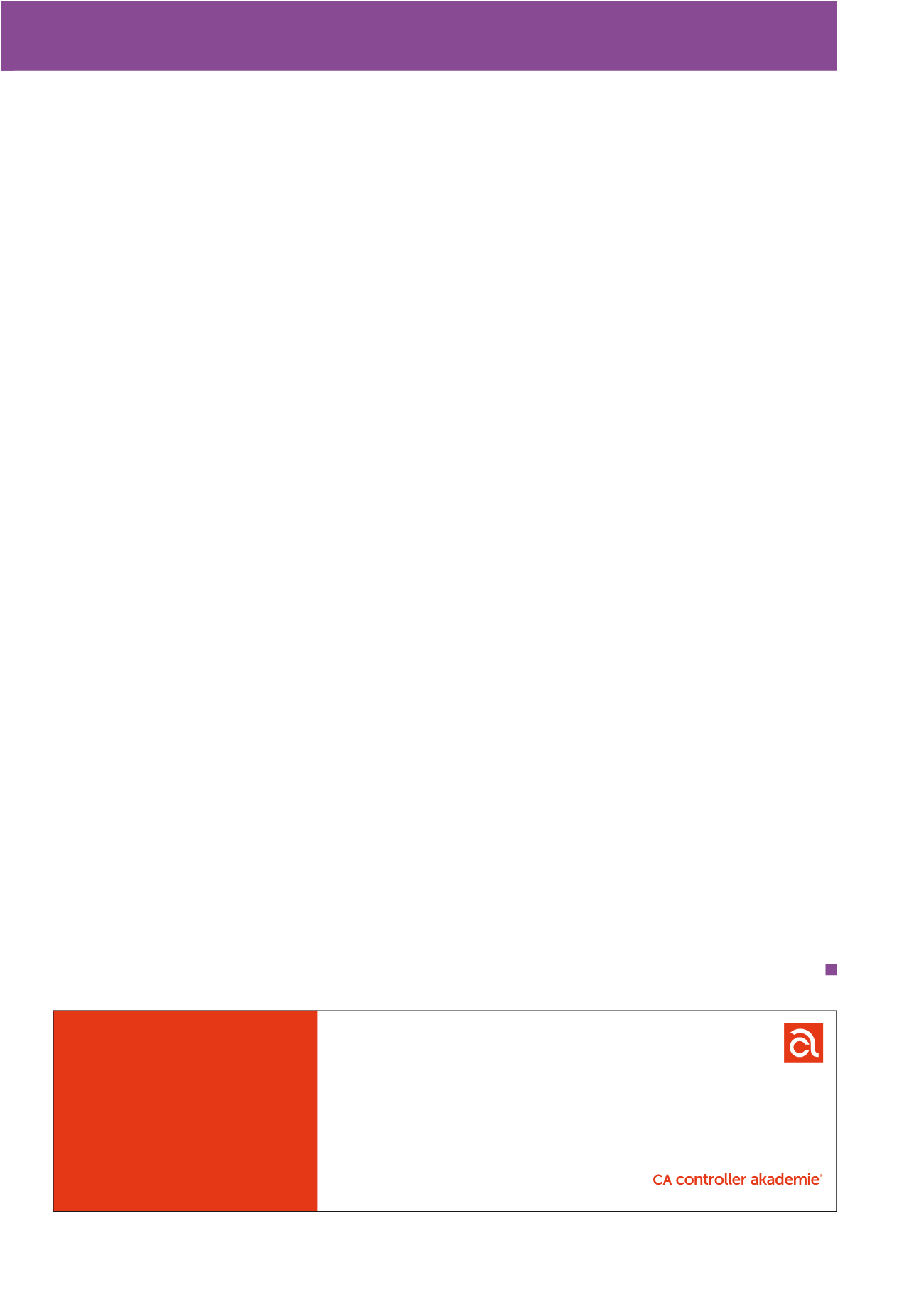
33
gebaut, was Investitionen in Maschinen und
Personal bedarf. Im weiteren Zeitverlauf wird
sich zeigen, ob die Mitarbeiter ausreichend
ausgebildet wurden, was sich etwa an den Ma-
terialaufwendungen (Verschnitt) in Spalte 2 und
3 sowie den Auszahlungen in Spalte 1 zeigen
wird. Zudem wird in diesen Spalten auch der
Erfolg des Produktes am Markt in Form eines
Umsatzvolumens und einer ausreichenden Um-
satzrentabilität und somit am Ergebnis deutlich.
Fazit
Durch den Einsatz eines Mehrspalten-Ab-
schlusses können die Möglichkeiten verbes-
sert werden, im Periodenvergleich zu zeigen,
wie Erfolge bei der Entwicklung von Werthal-
tigkeit schrittweise in Wertrealisierung über-
führt werden:
·
von den Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
mit ihren Prämissen und Annahmen für we-
sentliche Investitionen,
·
über die Erfolgsdarstellung mit ihren Doku-
mentationen und Abgrenzungen,
·
bis hin zu den tatsächlichen Zahlungsströ-
men und ihren Wirkungen auf die verfügbare
Liquidität.
Ein
wesentliches, mögliches Einsatzgebiet
des Mehr-Spalten-Abschlusses ist die Bestim-
mung einer
am langfristigen Erfolg orien-
tierten Vergütung von Führungskräften.
Gemessen werden die zunächst in der vierten
Spalte erscheinenden, aus den Wirtschaftlich-
keitsbetrachtungen abgeleiteten Potenziale und
ihre spätere Verwirklichung in der ersten Spalte
sowie die Geschwindigkeit der Umsetzung in
reale Liquidität (Spalte 1). Dabei werden zum
einen die Veränderungen ursprünglich ange-
setzter Prämissen und Annahmen und zum
anderen mangelnde Konsequenz in der Um-
setzung beschlossener Programme sichtbar.
Beides bietet vielfältige Möglichkeiten für
Verbesserungen in der Führungsarbeit der
betriebswirtschaftlichen Zielsetzung, Pla-
nung und Steuerung.
Fußnoten
1
Vgl. Lorson, P./Paschke, R.: Worum geht es
beim integrated thinking? – Ansätze zur Be-
griffsbestimmung und Umsetzung, in: Die Wirt-
schaftsprüfung, Heft 18/2015 – im Erscheinen.
2
Vgl. Freidank, C.-C./Müller, M./Velte, P.
(Hrsg.): Handbuch Integrated Reporting, 2015;
Lorson, P./ Kern, T./ McGuigan, N.: Integrated
Reporting, in: Zeitschrift für Corporate Gover-
nance, Heft 3/2014, S. 127-136.
3
Dazu ist eine Anmerkung erforderlich: Das
<IR>-Framework beschreibt sechs verschie-
dene Arten von „Capital“. Der Begriff „Capi-
tals“ wird im Glossar definiert als „Bestände an
Werten, von deren Input in das Geschäftsmo-
dell der Erfolg aller Organisationen abhängt
und die durch Geschäftsaktivitäten und Out-
puts erhöht, verringert oder transformiert wer-
den“. Wenn wir vom deutschen Bilanzver-
ständnis ausgehen, werden „Bestände an
Werten“ der Vermögensseite zugeordnet. Das
Kapital widerspiegelt demgegenüber die ver-
schiedenen Finanzierungsquellen für alle Arten
von Vermögen, wobei die Finanzierungsquellen
entweder dem Eigen- oder dem Fremdkapital
zugeordnet werden und damit die Interessen
der Stakeholder, Eigentümer oder Investoren
und Kreditgeber repräsentieren. Vermögensar-
ten und Finanzierungsquellen sind weder iden-
tisch noch kongruent. Deshalb haben die Auto-
ren den Begriff „Capital“ in diesem Kontext
grundsätzlich mit „Vermögen“ (im Sinne: für
das Geschäftsmodell verfügbare bzw. einge-
setzte Ressourcen) übersetzt.
4
Deutsche Übersetzung des Fachkreises „Con-
trolling & IFRS“ nach <IR>-Framework, De-
zember 2013, S. 13.; International <IR>
Unternehmen aus allen Wirtschaftsräumen der
Erde und wichtigen Wirtschaftsprüfungs-Orga-
nisationen auch die beiden bedeutendsten
Standardsetter IASB und FASB zusammenge-
schlossen. Es darf erwartet werden, dass das
Framework in den kommenden Jahren schritt-
weise in international verbindliche Regelwerke
für das Integrated Reporting umgesetzt wird.
5
Schmidt, W./Blachfellner, M./Oehler, K.: Mo-
derne Wertorientierung, 1. Aufl., 2015, S. 34f.
6
Lorson, P./Müller, S./Schmidt, W.: „Kapitalar-
ten“ des International Integrated Reporting
Council, in: DER BETRIEB, Nr. 12 vom
20.03.2015, S. 630.
7
Vgl. ICV, Facharbeitskreis IFRS und Control-
ling (Hrsg.): Impulspapier Drei-Spalten-Bilanz,
2011.
8
Vgl. Lachnit, L./Müller, S.: Unternehmenscon-
trolling, 2. Aufl., 2012, S. 253-290.
9
Vgl. Hahn, D./Hungenberg, H.: PuK – Wert-
orientierte Controllingkonzepte, 6. Aufl., 2001,
S. 23-24.
10
Vgl. Lachnit, L./Müller, S.: Unternehmens-
controlling, 2. Aufl., 2012, S. 271-279.
11
Vgl. Serven, L. B. M.: Value Planning, 1. Auf-
lage 2001, S. 36-37.
12
Vgl. D´Aveni, R.: Hyperwettbewerb, 1. Auflage
1995, S. 364. Gleichwohl sind Bereiche vor-
stellbar, in denen dieser Sachverhalt so nicht
gilt. So können etwa bestimmte Wissensvor-
sprünge durchaus sehr dauerhaft von Unterneh-
men gehalten werden, vgl. Schneider, M.: Kom-
plementaritäten – „Strategische Komplementa-
ritäten“ und das Management intangibler Res-
sourcen, in: Zfbf, Hyt Sep./2001, S. 589-604.
13
Vgl. Müller, S.: Management-Rechnungswe-
sen, 2003, S. 338.
Aktuelle Termine zum systematischen Trainingsprogramm in 5 Stufen:
Stufe I – Controllers Best Practice:
07. – 12. oder 14. – 18. Dez. 2015
Stufe II – Financial & Management Accounting:
14. – 18. Dez. 2015
Stufe III – Berichtswesen & Kommunikation für Controller:
14. – 18. Dez. 2015
Stufe IV – Planungsanwendungen & Umsetzung:
07. – 11. Dez. 2015
Stufe V – Präsentation & Moderation für Controller:
07. – 11. Dez. 2015
Die perfekte
Ausrüstung
für eine erfolgreiche Controlling
Karriere.
Mit einem in der Praxis
hoch geschätzten Abschluss.
Informieren und anmelden:
Unternehmenssteuerung in der Praxis
CM November / Dezember 2015