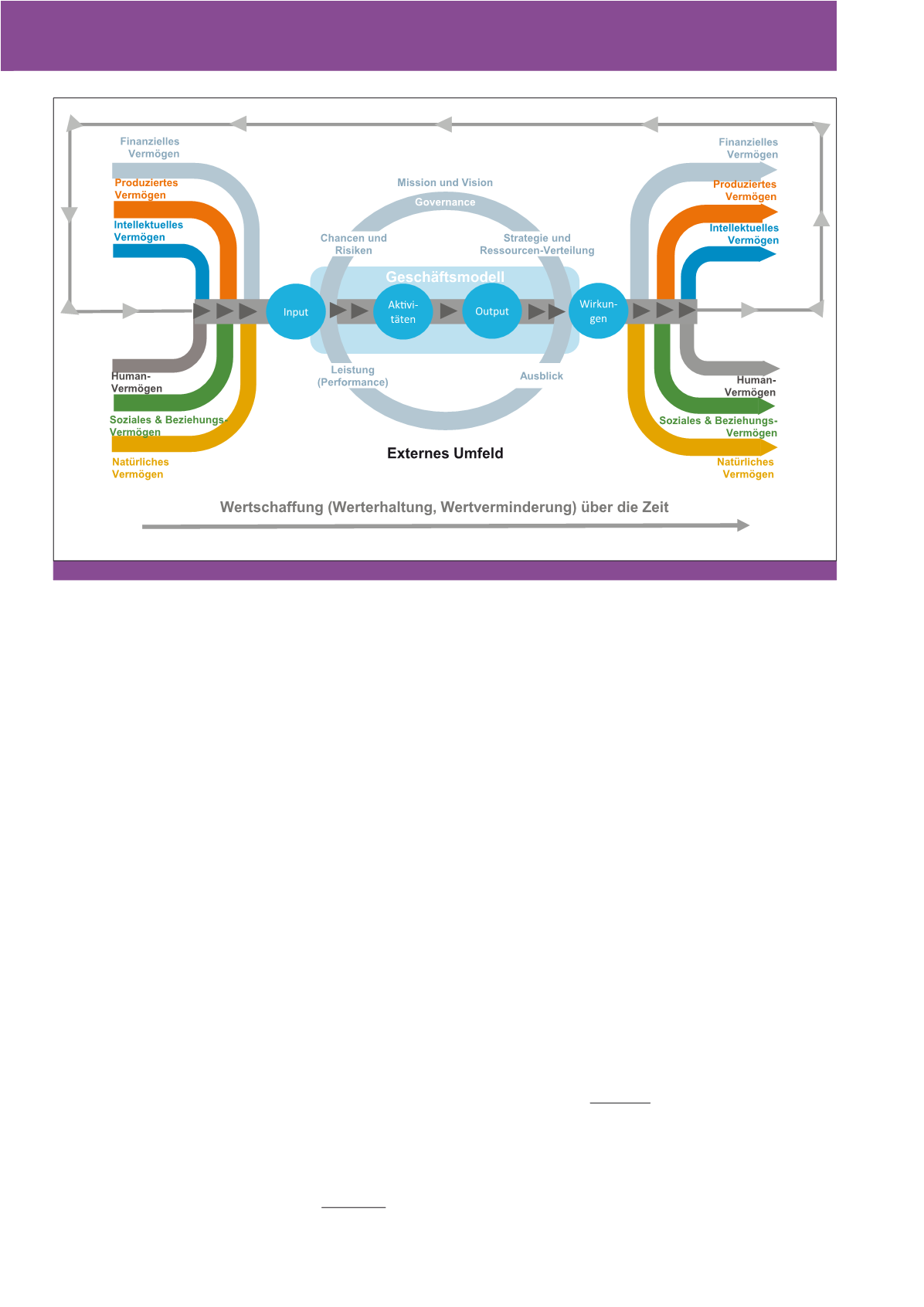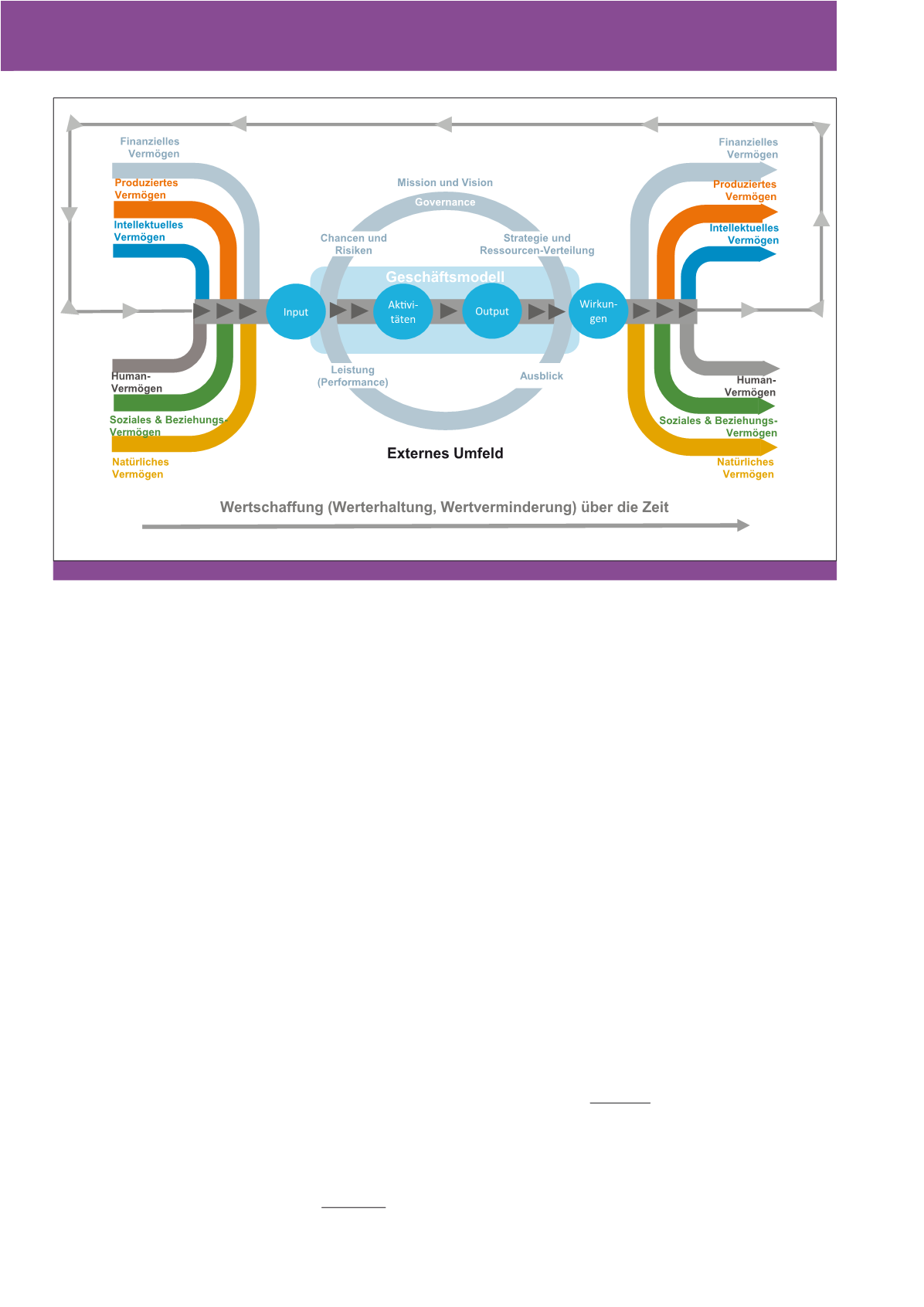
27
dabei erreichten Erfolge in reale Zahlungsströ-
me (Liquidität). Dabei besteht zwar ein Zusam-
menhang zwischen der Komplexität des Ge-
schäftsmodells und der Dauer des Prozesses
vom Potenzial zum Zahlungsstrom, doch auch
einfache Geschäftsmodelle benötigen zunächst
stets einen Vorlauf für den Aufbau von Potenzi-
alen in den Vermögensarten.
Beispiel
Für den Betrieb einer Kaffeebar müssen z. B. zu-
nächst Standortfragen geklärt, Personal rekru-
tiert und ggf. ausgebildet, Genehmigungen ein-
geholt, Maschinen und Ausstattung erworben
und aufgebaut, Marketingmaßnahmen durchge-
führt und die Produktzutaten beschafft werden.
Dabei obliegen dem Management die Entschei-
dungen über die Steuerung und ggf. zeitliche
Reduktionen der Prozesse, indem etwa im vor-
stehenden Beispiel frühzeitig kompetentes Per-
sonal eingestellt und so die Einarbeitungszeit
verringert oder ein bestehendes Café übernom-
men wird. Letztlich sind die Potenziale in den
Vermögensarten sowie der Prozess der Um-
wandlung in reale Zahlungsströme so aufeinan-
der abzustimmen, dass die gesetzten Ziele be-
züglich Wachstum, Entwicklung und Gewinn
des Unternehmens erreicht werden können.
Wertschaffung
versus Wertschöpfung
In der gegenwärtigen Diskussion über
Integ-
rated Thinking
1
& Integrated Reporting
2
(<IR> = integriertes Denken & integriertes Be-
richten) wird die Wertschöpfung über die Zeit
im englischsprachigen Original als
Value
Creation
(deutsch:
Wert-Schaffung
) bzw.
Preservation
(deutsch:
Bewahrung
) oder
Di-
minution
(deutsch:
Verminderung/Schmä-
lerung
) bezeichnet. Dabei soll eine kurz-, mit-
tel- und langfristige Beurteilung vorgenommen
und zwischen sechs Vermögensarten differen-
ziert werden. Wenn im weiteren Text auf diese
differenziertere Betrachtung abgestellt wird,
gilt es Folgendes zu bedenken: Wir haben
„Wertschöpfung“ explizit im Sinne von „nach-
haltiger Wertschöpfung“ und implizit im Sinne
von „nachhaltiger positiver Wertschöpfung“
definiert. Folglich kann vereinfachend der bis-
herige Begriff der Wertschöpfung mit einer
langfristigen Erhöhung des Gesamtwertes aller
Vermögensarten gleichgesetzt werden (siehe
Abbildung 2).
Abbildung der Wertschöpfung /
Wertschaffung
Die gegenwärtigen Rechnungslegungsvor-
schriften spiegeln dieses integrierte Herange-
hen nicht wider. Das betrifft zwei Aspekte:
1. Die Vollständigkeit der Bilanz.
2. Die zeitbezogene Wechselwirkung und deren
Steuerungsnotwendigkeit.
Die Vollständigkeit der Bilanz
Seit vielen Jahren gibt es gemeinsame Bestre-
bungen des International Accounting Standards
Board (IASB) und des US-amerikanischen
Financial Accounting Standard Board, die interna-
tionale Bilanzierung in Richtung „Vollständigkeit“
zu entwickeln. Die Erfassung der Vermögens-
werte als Potenziale oder die Einführung des Fair
Value waren beispielhafte Schritte auf diesem
Weg. Das unter maßgeblicher Mitwirkung von
IASB und FASB entstandene <IR>-Modell (siehe
Abbildung 2) zeigt, wohin die Richtung gehen soll.
Dabei sind noch viele Fragen offen – vor allem
zur aktiven Abgrenzung und Bewertung der
Vermögensarten und zu dem passiven Ausweis
ihrer Finanzierung. Der ICV hat im Leitfaden
Abb. 2: Integriertes Denken und Berichten
4
CM November / Dezember 2015