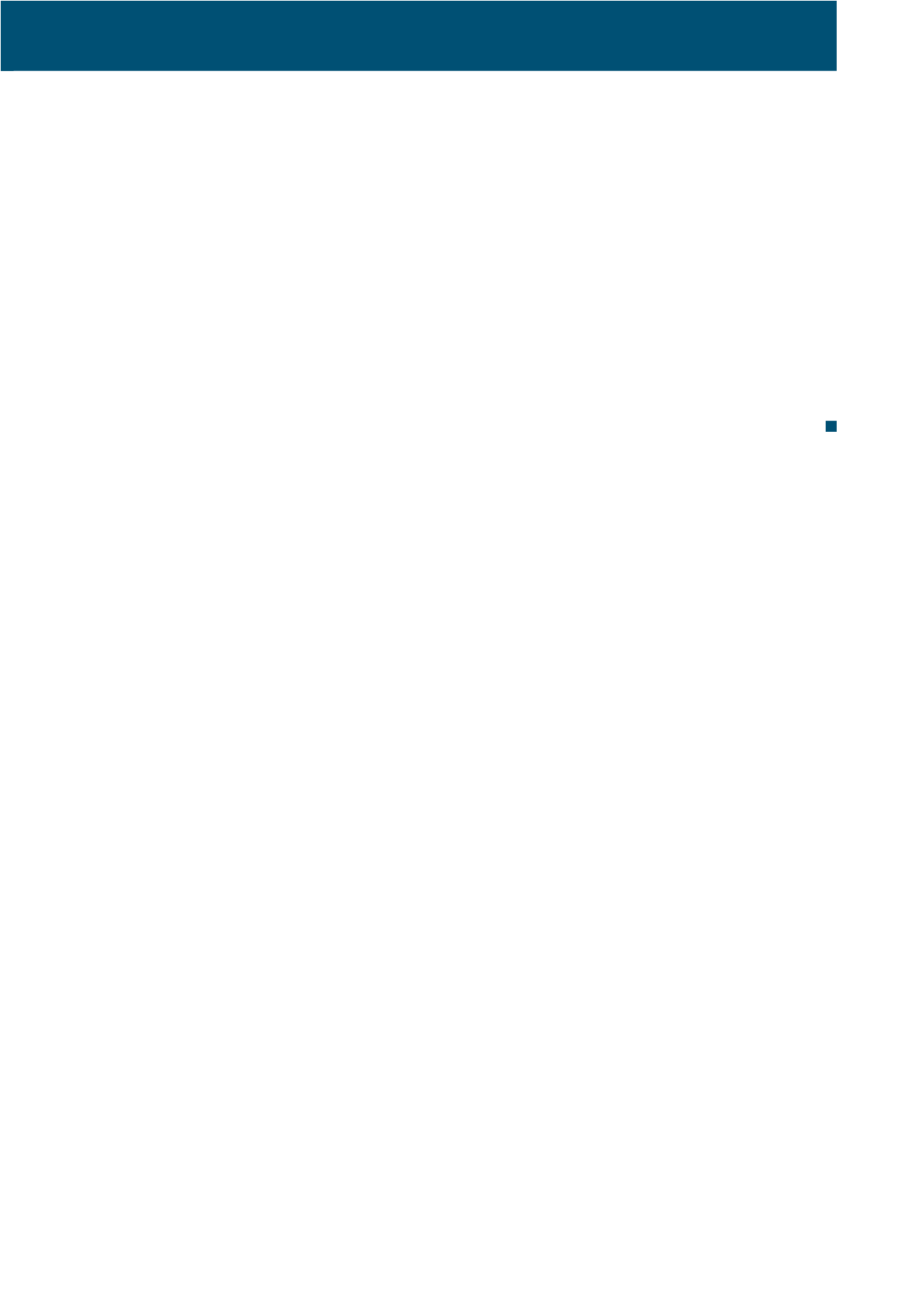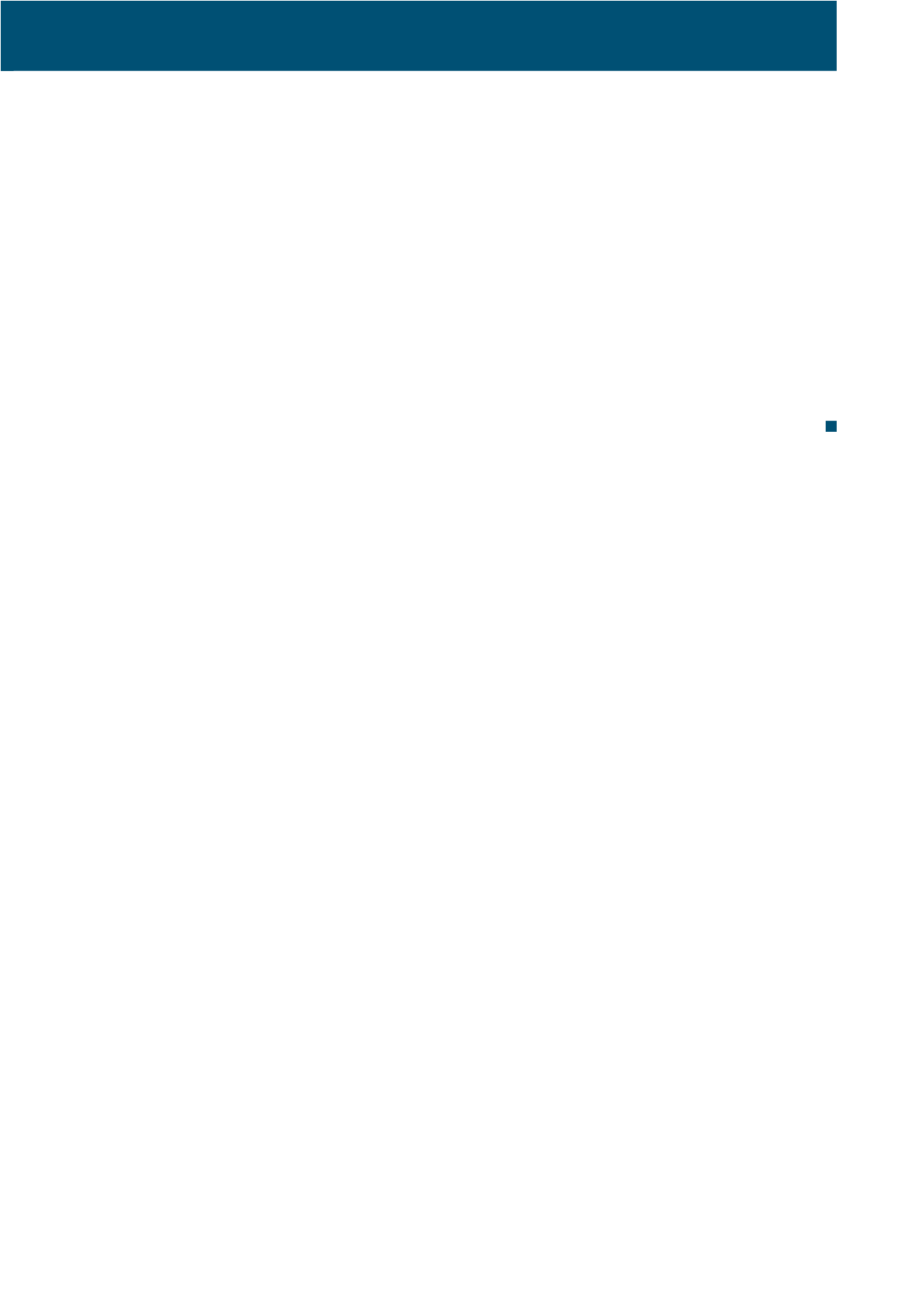
39
der
Sachverhaltsgestaltung
, also lasse ich
bestimmte Geschäftsvorfälle im Berichtsjahr
noch eintreten oder nicht,
mittlerweile eine
wesentlich größere Bedeutung zukommt
als der Darstellungsgestaltung
, die primär
auf Basis der existierenden Ansatz- bzw.
Bewertungswahlrechte durchgeführt wird.
Schließlich wurden die in der Vergangenheit
existierenden Wahlrechte durch die Bilanz-
rechtsreformen deutlich reduziert.
Biel:
Herr Prof. Dr. Brösel, was schlussfolgern
Sie daraus als Wissenschaftler?
Brösel:
Insofern können wir uns beim Ge-
setzgeber für undurchsichtigere Jahresab-
schlüsse bedanken
, denn bei der Ausnutzung
expliziter Wahlrechte ist zumindest noch eine
Tendenz der Bilanzpolitik aus dem Abschluss
erkennbar. Die Sachverhaltsgestaltung bleibt
unentdeckt!
Biel:
Dies führt uns einen Schritt weiter. Der
Lagebericht unterliegt der Prüfung durch den
Abschlussprüfer bzw. der Abschlussprüferin
durch sogenannte analytische Prüfungshand-
lungen. Was bedeutet dies für die Praxis?
Wo verlaufen die Grenzlinien für eine sichere
Prüfung?
Brösel:
Der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer
steht hier vor einer großen Herausforderung,
weil er mit dem Testat auch für qualitative Aus-
sagen die Verantwortung übernimmt. Dies ist
vor allem für den Risiko- und den Prognosebe-
richt kritisch anzusehen. In der Literatur wird
davon gesprochen,
dass er die „weichen“ In-
formationen mit seinem Testat „härten“
soll
. Nach sinnvollen Hilfestellungen sucht man
in der Literatur oft vergebens.
Freichel:
Gegenstand und Umfang der Prü-
fung des Lageberichts ergeben sich aus den
gesetzlichen Vorschriften. Hier sind die §§
317 Abs. 2, 321 und 322 HGB zu nennen.
Entsprechend hat der Abschlussprüfer ge-
mäß § 317 Abs. 2 HGB zu prüfen, ob der La-
gebericht – vor dem Hintergrund der bei der
Prüfung gewonnen Erkenntnisse – mit dem
Jahresabschluss in Einklang steht und ob der
Lagebericht insgesamt eine zutreffende Vor-
stellung von der Lage des Unternehmens ver-
mittelt. Zudem ist zu beurteilen, ob die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend dargestellt sind. Dem Prüfer ist zu
empfehlen, die Prüfung an der Einhaltung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichter-
stattung i. S. d. DRS 20 auszurichten. Generell
gilt, dass der Lagebericht mit der gleichen
Sorgfalt wie der Jahresabschluss zu prüfen
ist. Es ist – wie bei anderen Prüffeldern auch
– der
risikoorientierte Prüfungsansatz an-
zuwenden
. Im Sinne des risikoorientierten
Vorgehens sind sämtliche Prüfungstechniken
relevant. Daher sind neben den von Ihnen an-
gesprochenen analytischen Prüfungshandlun-
gen auch Systemprüfungen sowie Einzelfall-
prüfungshandlungen vorzunehmen.
Biel:
Wie umfassend, wie intensiv ist der Lage-
bericht zu prüfen?
Freichel:
Bei der Prüfung des Lageberichts
handelt es sich um eine Art der
„Vollprüfung“
.
Schließlich ist zu überprüfen, ob sämtliche
Anforderungen an die Lageberichterstattung
eingehalten sind. Eine Prüfung lediglich aus-
gewählter Berichtsbestandteile als Auswahl-
prüfung wird dem nicht gerecht. Dennoch kann
die Prüfungsintensität der einzelnen Bereiche
risikoorientiert angepasst werden.
Biel:
Und wie prüft man „Zukunft“?
Freichel:
Da der Lagebericht im Wesentlichen
zukunftsorientierte und beurteilende Elemente
enthält, kommen in der Tat vor allem analytische
Prüfungshandlungen in Betracht. Analytische
Prüfungshandlungen
zielen auf die Nachvoll-
ziehbarkeit der Angaben durch den Prüfer
unter Berücksichtigung der bei der Prüfung
gewonnenen Erkenntnisse sowie Erwartungen.
Bezüglich der Verlässlichkeit der Beurteilungen
auf Basis der analytischen Prüfungshandlungen
muss sich der Prüfer jedoch darüber bewusst
sein, dass diese im Vergleich zu den übrigen
Prüfungshandlungen am schwächsten ist.
Biel:
Und wie verlässlich ist nun diese Prüfung?
Wie belastbar sind diese Prüfungsergebnisse?
Freichel:
Damit ist in der Tat das
Sicher-
heitsniveau bei Abschlussprüfungen
an-
gesprochen. Eine absolute Sicherheit ist mit
einer handelsrechtlichen Abschlussprüfung
generell nicht zu erreichen, weil diese das
Konzept der hinreichenden Sicherheit verfolgt.
Schließlich besteht auch bei einer ordnungs-
gemäß durchgeführten Abschlussprüfung
aufgrund
der bei jeder Abschlussprüfung
innewohnenden begrenzten Erkenntnis-
und Feststellungsmöglichkeiten
, z. B. auf-
grund eines temporär unwirksamen IKS, ein
unvermeidbares Risiko, dass falsche Aussa-
gen nicht entdeckt werden können. Hinrei-
chende Sicherheit bedeutet jedoch zumindest
einen hohen Grad an Sicherheit. Exakt quanti-
fiziert werden kann dies jedoch nicht. In Mas-
senfällen im Zusammenhang mit mathema-
tisch-statistischen Stichprobenverfahren
geht
die Praxis von einem Sicherheitsgrad von
90 bis 95% aus.
CM Januar / Februar 2016