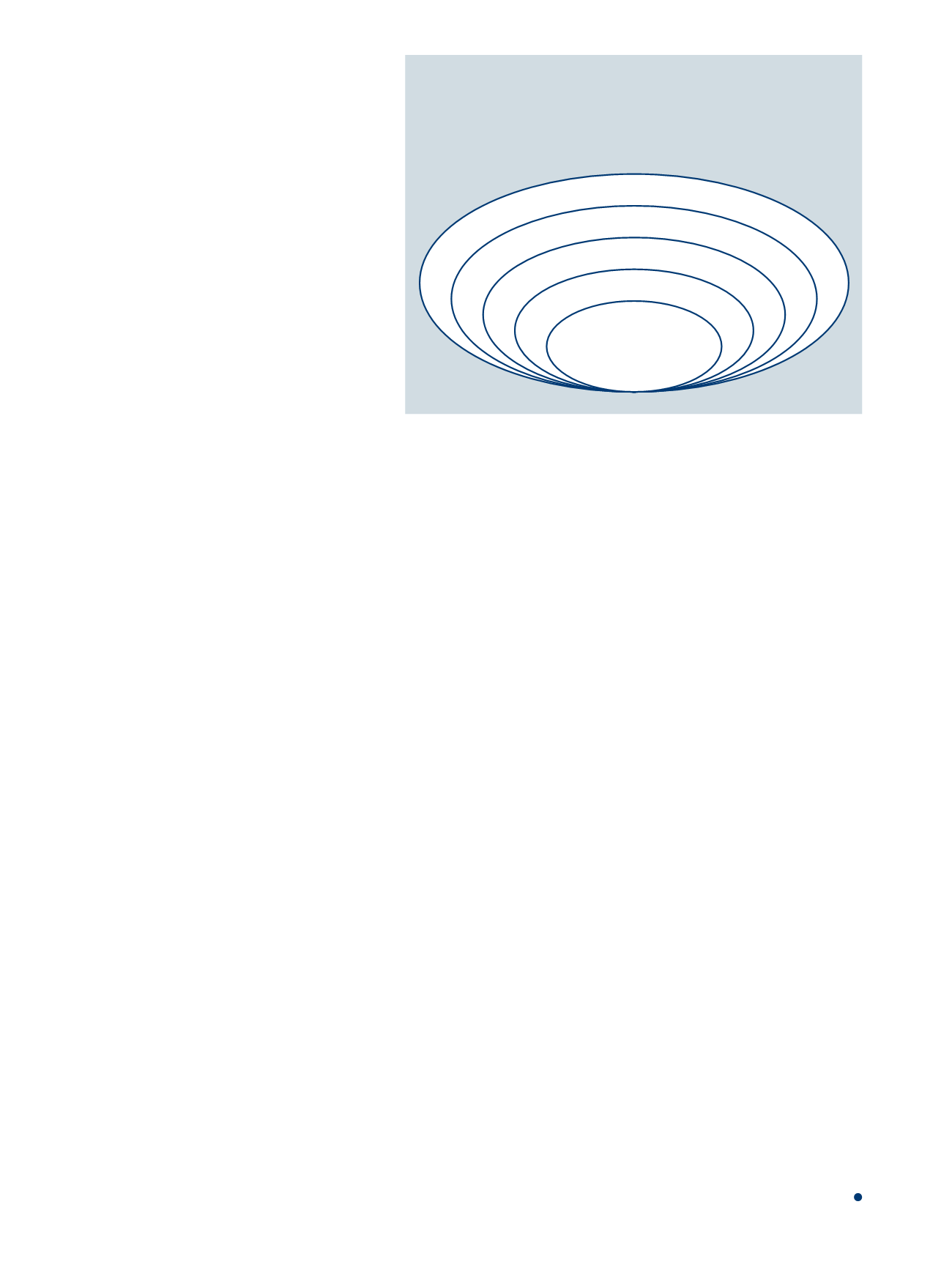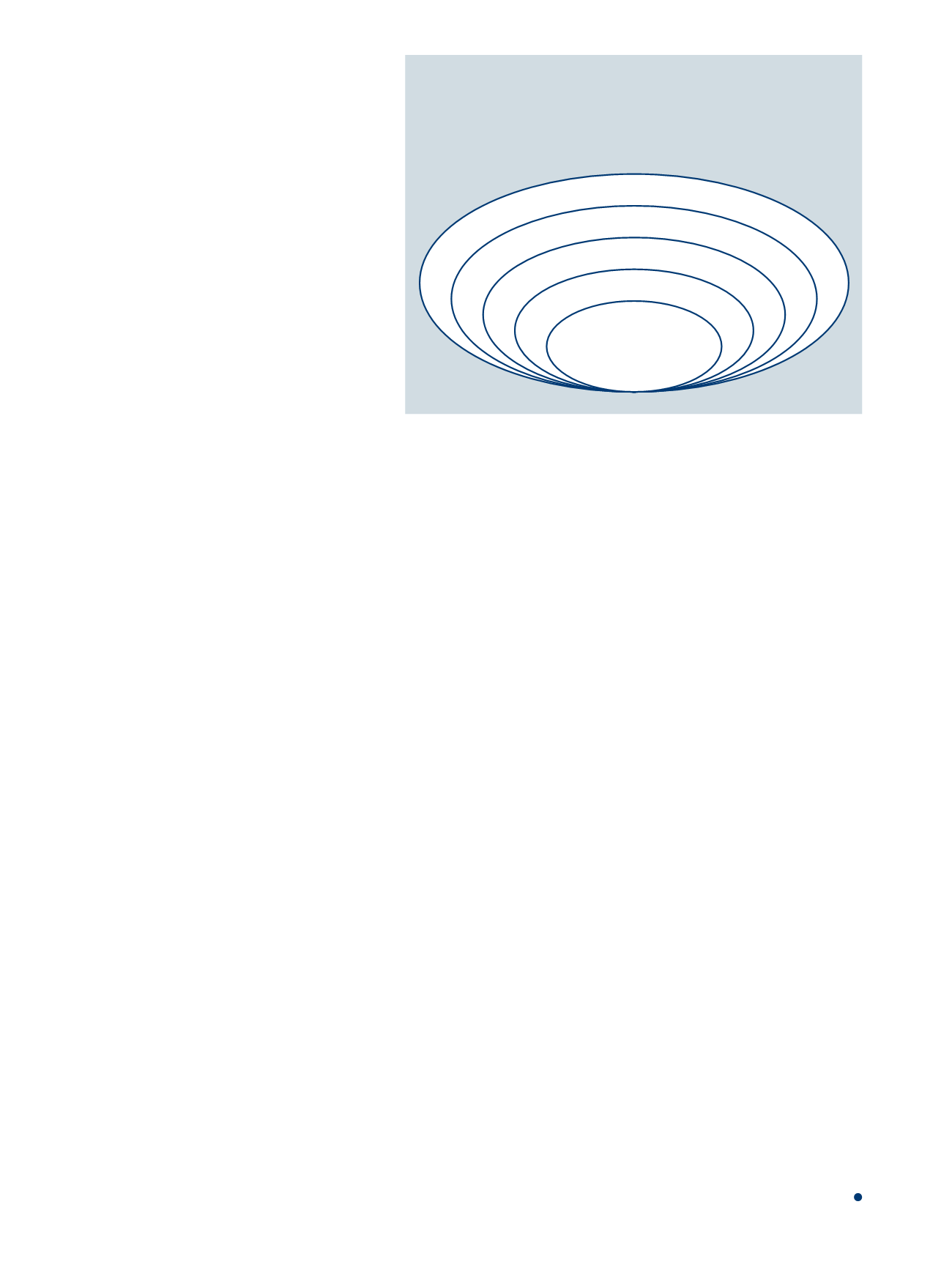
wirtschaft + weiterbildung
07/08_2016
39
nicht auf der Kultur. In der Beratung
muss darauf geachtet werden, ob sich das
Kundensystem in seinen Interventions-
ideen direkt auf die Unternehmenskultur
richtet, was häufig der Fall ist („Wir müs-
sen unsere Führungskultur verändern“).
In der Zusammenarbeit sollte eine Umfo-
kussierung der Aufmerksamkeit auf Per-
sonen, Programme und Kommunikations-
wege versucht werden.
2. Prinzipien.
Bei den Interventionsprin-
zipien geht es um die Reflexion der ver-
schiedenen Möglichkeiten der Einfluss-
nahme. Zu unterscheiden sind zunächst
Minus- und Plussymptome. Eine Minus-
symptomatik beschreibt eine Unterlas-
sung, Muster sind nicht zu beobachten,
die lieber beobachtet werden würden
(„Die Führungskräfte geben kein Feed-
back“). Bei der Plussymptomatik werden
Aktionen beobachtet, die lieber nicht be-
obachtet werden würden („Es herrscht
ein schroffer Umgangston“). Beiden Sym-
ptomtypen sind Prozessmuster gemein,
die in Unternehmen dafür sorgen, dass
sie in der Kommunikation hergestellt und
aufrechterhalten werden. Die Frage, die
sich vor jeder Intervention stellt, lautet
deshalb: Sollen neue Muster etabliert
werden, oder sollen etablierte Muster
unterbrochen, verhindert bzw. verändert
werden?
Da die Unternehmenskultur konserva-
tiv ist, wird es oftmals der leichtere Weg
sein, neue Muster zu etablieren, die dann
an die Seite der bisherigen Muster treten
und sie in ein anderes Licht rücken, sie
abschwächen oder vielleicht mit der Zeit
ersetzen oder den Impuls für die Entste-
hung eines noch weiteren neuen Musters
geben. Weitere Interventionsprinzipien
ergeben sich mit Blick auf Variations-
und Selektionsfragen. Die Variation von
Mustern kann beeinflusst werden, indem
zum Beispiel Feedbackübungen in einem
Seminar angeboten werden. Aber auch
die Selektion von Mustern kann beein-
flusst werden. Wenn die Führungskräfte
für jedes Feedbackgespräch Punkte von
ihren Mitarbeitenden bekämen und sie
am Ende eines Zyklus vorzeigen müss-
ten, könnte die Selektion dieses Musters
wahrscheinlicher gemacht werden.
3. Architektur.
Der Interventionsarchitek-
tur kommt eine besondere Bedeutung zu,
gerade auch angesichts des Gedankens
der Nichtkontrollierbarkeit. Sie beginnt
bereits bei der Frage, wer in welcher Rolle
am Veränderungsgeschehen beteiligt ist.
Statt Beratung als Auslagerung von Kom-
petenzen zu verstehen (ein „Abkippen“
von Problemen nach extern in der Hoff-
nung, dort eine Lösung herangezüchtet
zu bekommen, die im eigenen Unterneh-
men lediglich eingepflanzt werden muss),
sollten sich Berater und Kunden gemein-
sam in einem Beratungssystem für die zu
erreichenden Ziele zusammenfinden.
Ein Aspekt der Architektur ist dann zum
Beispiel die Vereinbarung, wie häufig
sich das Beratungssystem zusammenfin-
det und mit welchem Selbstverständnis
gemeinsam gearbeitet wird. Bei der Inter-
ventionsarchitektur geht es auch um die
Auswahl und den individuellen Zuschnitt
der geeignet erscheinenden Kommunika-
tionsformate wie Workshops, Fokusgrup-
pen, Interviews, Großgruppenevents,
Reflexionsmeetings, Einzel- oder Grup-
pencoachings, Teamentwicklungen, Stra-
tegiekonzeptionen. Ein weiterer Aspekt
sind die Akteure, die berücksichtigt wer-
den sollen: Einzelpersonen, Teams, Abtei-
lungen, Bereiche, Standorte, Sparten usw.
Und schließlich muss die Zeitdimension
einfließen, also Überlegungen dazu, in
welchem Abstand über welchen Zeitraum
wer mit wem kommunizieren sollte.
4. Techniken.
Bei den Interventionstechni-
ken geht es um die Frage, wie genau die
einzelnen Formate ausgestaltet werden
sollen, welche Methoden zum Einsatz
kommen sollen, damit die gewünschten
Effekte befördert werden. Gemeint sind
etwa zirkuläre Fragetechniken, Erlebnis-
gestaltung, Aufstellungen, Reflexions-
räume, Präsentationen, Impulsvorträge,
Großgruppenformate wie Open Space,
Reflecting Team, Feedback und vieles
mehr. Interventionstechniken sollten so
ausgewählt und kombiniert werden, dass
einerseits die größte Anschlussfähigkeit
bezüglich des Systems zu vermuten ist
und andererseits die Wahrscheinlich-
keit hoch erscheint, das System in die
gewünschte Richtung zu beeinflussen.
Methoden müssen kontextspezifisch fein-
konzipiert werden. Kontextsensitivität ist
dabei ein Erfolgsprinzip. Auch kommt der
Beobachtung der Interventionstechniken
und ihrer Auswirkungen im System eine
bedeutsame Rolle zu.
Mit Gestaltungsaufgaben betraute Perso-
nen sollten ihre Beobachtungen in regel-
mäßigen und schnellen Zyklen reflektie-
ren und weitere Interventionen auf das
Gelernte und die daraus neu zu bildenden
Hypothesen ausrichten. Eine mitlaufende
Beobachtung 2. Ordnung ist das A und
O wirksamer Interventionen. Für die Pra-
xis der Interventionen meint dies, sich zu
wundern über das, was andere für selbst-
verständlich halten. Wer sich in seiner
Interventionspraxis nur auf diese äußere
Ebene des Schalenmodells, die Metho-
den, reduziert und sie womöglich kon-
textfrei anwendet, bleibt weit hinter den
Möglichkeiten zurück. Methoden sollten
das Denken nicht verhindern. Mit Blick
auf die vielen Manuale oder Tools, wie sie
bei Führungs- und Beratungsausbildun-
gen häufig angeboten werden, kann man
sich schon Sorgen machen.
Christina Grubendorfer
Schalenmodell der Intervention
Kultur verändern.
Das Schalenmodell von Simon, Weber & Friends aus
dem Jahr 2015 bietet die Möglichkeit, Interventionen strategisch zu
planen und aus der Theorie die sinnvollsten Techniken abzuleiten.
Quelle: Simon, Weber & Friends
Interventionstechniken
Interventionsarchitektur
Interventionsprinzipien
Interventionsfokus
Interventionstheorie