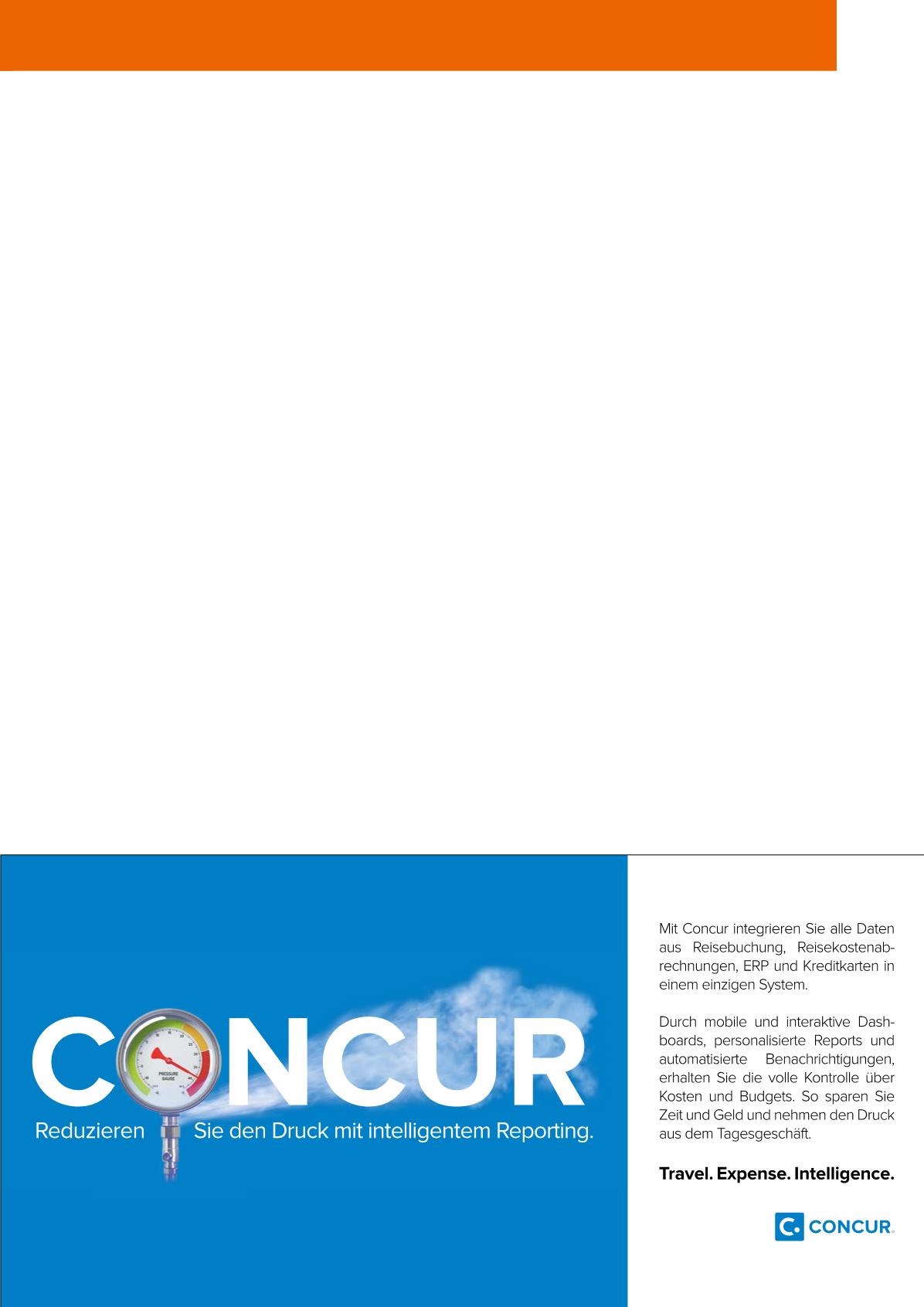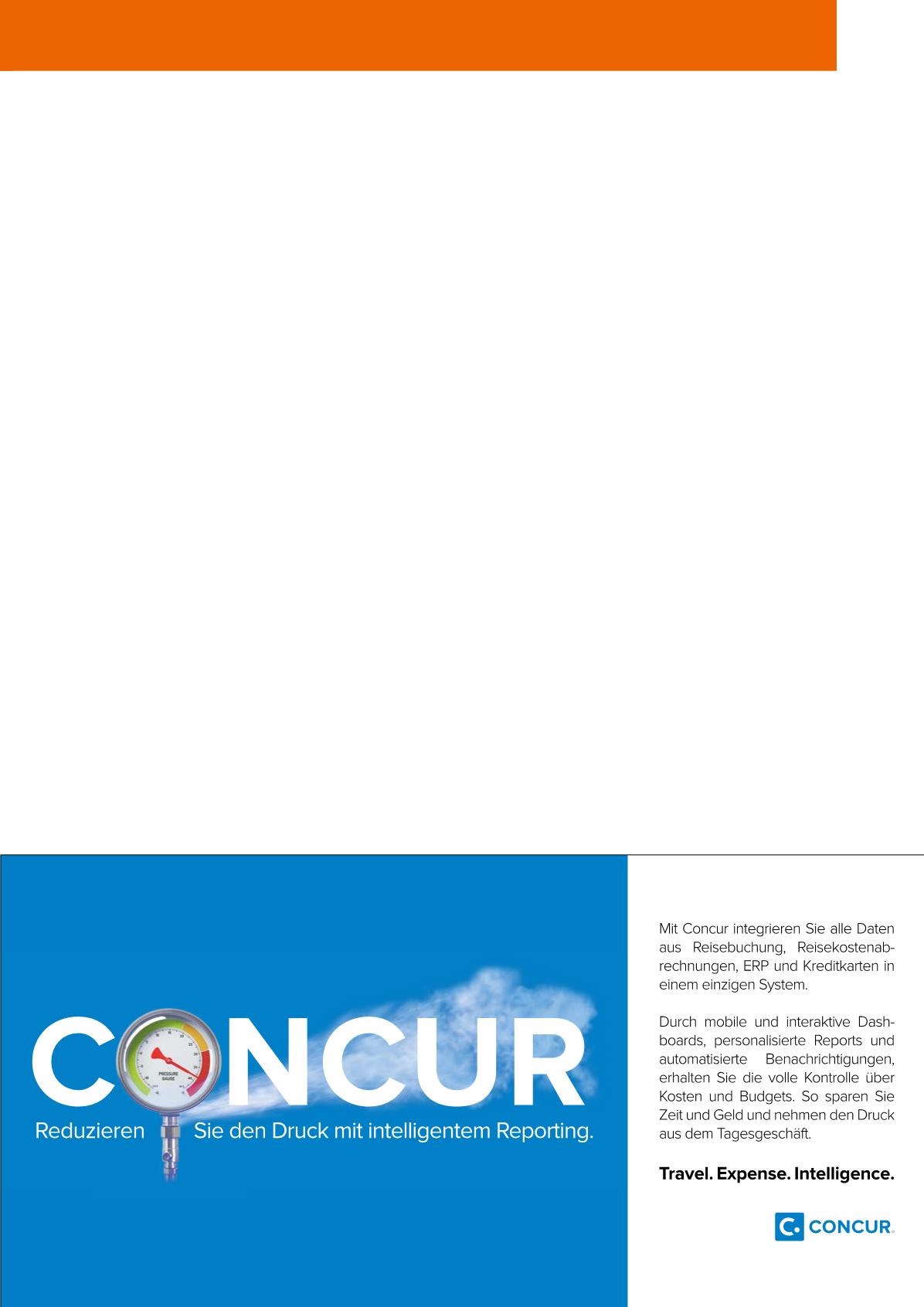
Weißenberger:
Richtig – es kommt also nicht
auf den „Lehrbuchcharakter“ eines Instru-
ments an, denn da wäre zum Beispiel das Prä-
sentationsformat der Informationen relativ
gleichgültig,
sondern eben auf den jeweili-
gen Kontext und die Art der Informations-
verarbeitung.
Und visuelle Informationen las-
sen sich eben deutlich leichter und einfacher
verarbeiten als tabellarische oder in Textform
präsentierte Informationen, sodass das Sys-
tem 1 nicht so schnell in die Irre geführt wird.
Biel:
Müssen wir nun – zugespitzt gefragt –
den Schluss ziehen, dass Controllerinnen und
Controller auch Psychologen sein sollen?
Weißenberger:
Nein, hier würden wir das
sprichwörtliche Kind mit dem Bade ausschüt-
ten, wenn wir jetzt von den Controllerinnen und
Controllern auch noch verlangen würden, Psy-
chologen zu sein. Notwendig ist vielmehr eine
Offenheit dahingehend, dass es eben
auch auf
die Form von Informationspräsentation,
Analyse und Beratung ankommen kann
–
und dass es deshalb durchaus sinnvoll sein
kann, Gestaltungsvorschläge, die auf psycholo-
gischen Theorien basieren, tatsächlich anzu-
wenden, selbst wenn die eigene Präferenz sehr
nah am rationalen Denken bzw. System 2 liegt.
Wer sich aber deutlich intensiver mit psycholo-
gischen Theorien auseinandersetzen muss, das
sind wir Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler – und das hört an dieser Stelle noch
lange nicht auf.
Biel:
Bitte führen Sie diesen Aspekt unseren
Leserinnen und Leser etwas aus? Was dürfen
wir erwarten?
Weißenberger:
Ja, sehr spannende Entwick-
lungen sind beispielsweise auch in der
Neuro-
ökonomie
zu erwarten. Dieses noch ganz jun-
ge Forschungsfeld untersucht neurophysiologi-
sche Prozesse im Gehirn und leitet daraus Ver-
haltensempfehlungen ab. Nehmen Sie zum
Beispiel den bekannten Crowding-Out-Effekt:
Dabei geht es ja um die Verdrängung intrinsi-
scher Motivation durch extrinsische Anreize.
Mit anderen Worten, wenn Sie jemanden für et-
was materiell belohnen, was dieser bisher frei-
willig getan hat, dann ist er in vielen Fällen nicht
mehr bereit, sich ohne Belohnung zu enga
gieren. Interessanterweise zeigt eine jüngere
neuroökonomische Untersuchung meines Düs-
seldorfer Kollegen Peter Kenning im Journal
of Economic Psychology, dass extrinsische Be-
lohnungen die Hirnareale, in denen es um die
Aufgabe als solche geht, nicht beeinflussen,
sondern vor allem die Hirnareale, in denen die
Beurteilung der Belohnung selbst verortet ist.
Biel:
Was haben wir daraus zu folgern?
Weißenberger:
Diese Erkenntnis bestätigt
nicht nur die psychologische Interpretation des
Crowding-Out-Effekts, sondern zeigt auch
noch einmal, dass
Incentivierungssysteme
auch im Controlling nur sehr vorsichtig ein-
gesetzt
werden sollten. Also es gibt noch viel
zu tun und viele Ansatzpunkte, um gestaltungs-
orientierte Hinweise zur Optimierung der Con
trollinginstrumente zu geben.
Biel:
Welche Tipps können Sie unseren Lese-
rinnen und Lesern ganz konkret geben, um Ent-
scheidungsfehlern vorzubeugen?
Weißenberger:
Hier stehen wir mit unserer
Forschung im Controlling natürlich bei Weitem
noch nicht am Ende, aber es gibt schon eine
Reihe von sehr hilfreichen Ratschlägen.
·
·
Erstens sollten sich Controller sehr bewusst
und systematisch mit
Entscheidungsver-
zerrungen bzw. gedanklichen Abkür-
zungen im Sinne von Biases auseinan-
dersetzen.
Denn auch wenn es das Auftre-
ten solcher Biases nicht verhindert, ist es
der erste Schritt eines De-Biasing, also ei-
ner Bewältigung oder zumindest Reduktion,
die Akzeptanz, dass Entscheidungen nicht
immer rational ablaufen. Nehmen wir bei-
spielsweise das Anchoring Bias, d. h. das
(unbewusste) Setzen von mentalen Bezugs-
punkten für die Beurteilung von Sachver-
halten. Wenn in einer Sitzung über Investi
tionsanträge entschieden werden soll, die
nach ihrer Höhe absteigend geordnet sind,
dann werden die letzten Anträge im Zweifel
als relativ niedrig und unbedeutend ange-
sehen, weil durch die ersten und hochvolu-
migen Anträge ein entsprechend hoher An-
ker gesetzt wurde. Und möglicherweise
CM Juli / August 2016