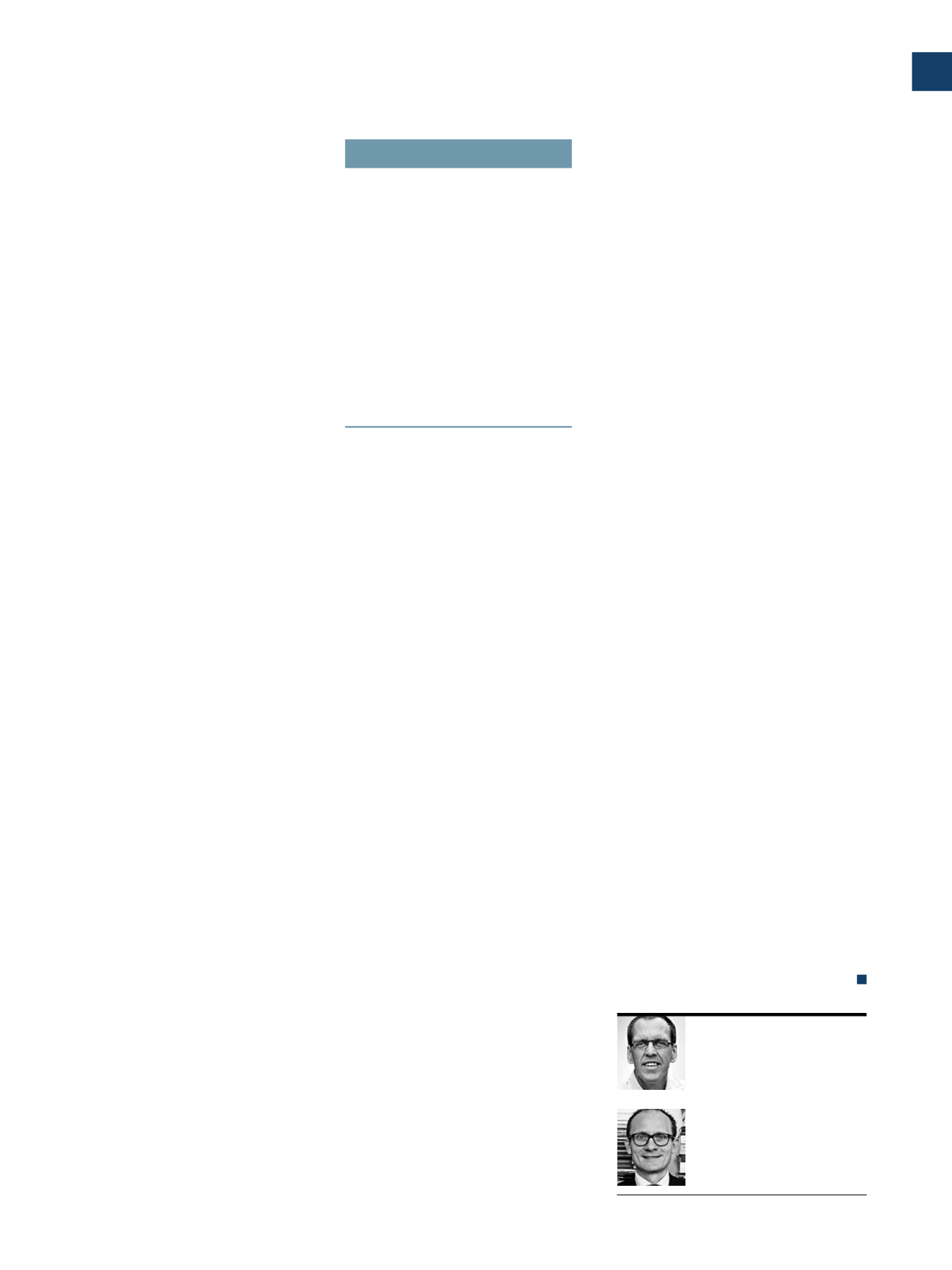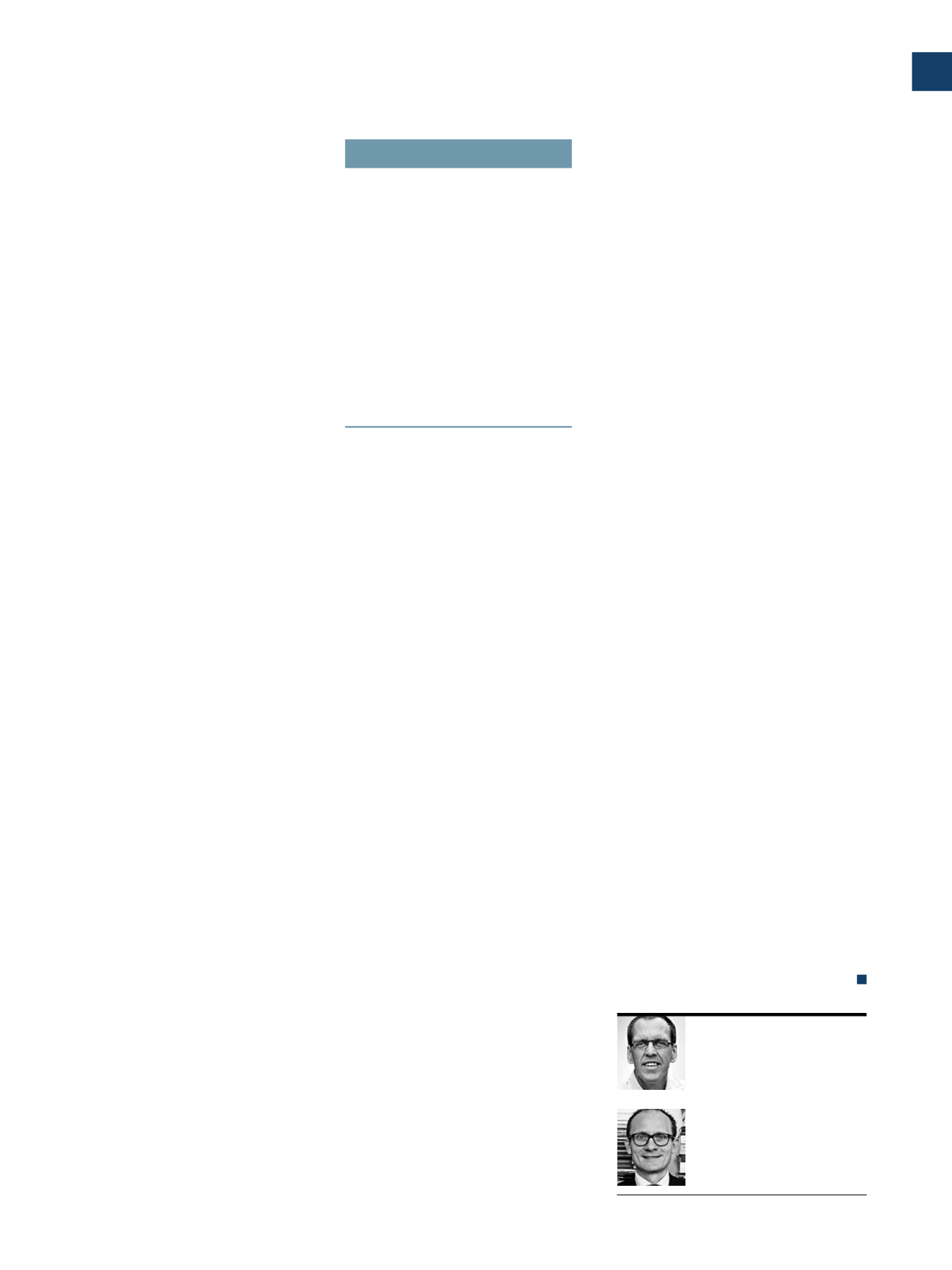
41
09/15 personalmagazin
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
dürfnisse samt Rivalität um die Produk-
te reduzieren die Leistungsfähigkeit von
„Open Collaboration“ überraschender-
weise kaum. Die Wissenschaftler prog-
nostizieren daher eine weitere Zunah-
me von offener Zusammenarbeit und
bezeichnen sie als neuartige Organisa-
tionsform, die eine echte Konkurrenz
für traditionelle Unternehmen mit ihren
starren Grenzen nach außen und har-
schen Regeln nach innen bringt – zumal
es bei vielen Individuen der westlichen
Gesellschaften einen großen Willen und
oft schon Drang zur Partizipation gibt.
Für wen oder was das Ganze gilt
Die offene Zusammenarbeit fordert das
volkswirtschaftliche Menschenbild vom
„Homo Oeconomicus“ mit seiner puren
Ich-Bezogenheit heraus. Warum verhal-
ten sich Menschen, zumindest viele und
zumindest gelegentlich, uneigennützig
ohne direkten persönlichen Vorteil? Die
Studienautoren zitieren dazu eine ande-
re, verhaltenswissenschaftliche Studie,
die das ökonomische Axiom vom Ego-
isten deutlich relativiert. Nach ihr gibt
es in der Bevölkerung rund 13 Prozent
uneigennützige Altruisten, eine große
Mehrheit von 63 Prozent ausgewogen
Kooperationsbereite, die nach dem Prin-
zip „Ich gebe, damit du gibst“ agieren,
und lediglich 20 Prozent selbstsüchtige
Trittbrettfahrer. Sie widersprechen damit
der von ihnen ebenfalls zitierten These
von Edgeworth aus dem Jahr 1881: „Jeder
Mensch ist ausschließlich durch sein Ei-
geninteresse getrieben“.
Die Studie unterstützt mit ihren Ergeb-
nissen das humanistische Menschenbild.
Ein Humanist sei – wie Jakob Augstein
unlängst anmerkte – je nach den Umstän-
den manchmal ein Linker, manchmal ein
Konservativer, manchmal ein Liberaler,
aber er kann nie ein Reaktionär sein.
Also, lassen wir uns nicht allzu schnell
von vermeintlichen ökonomischen Sach-
zwängen einnebeln, sondern benutzen
mit Selbstbewusstsein unseren gesun-
den Menschenverstand, wenn es wie-
der einmal heißt: Die Märkte erfordern
dies und das. Menschen sind manchmal
beitragswilliger als es die ökonomische
Theorie und die harten Hunde im Ma-
nagement wahrhaben möchten.
Der wichtigste und der nachdenk
lichste Satz
Der wichtigste Satz in der Studie lautet:
„Viele Menschen sind zu ihrem Beitrag
für die offene Zusammenarbeit bereit,
selbst wenn dieser mit Kosten für sie
verbunden ist und eine Gegenleistung
nicht garantiert wird“ (Seite 1.415).
Der nachdenklichste Satz in der Studie:
„Es gibt bei der offenen Zusammenarbeit
eine sehr große Unausgewogenheit der
individuellen Beiträge. Wenige uneigen-
nützige Altruisten steuern sehr viel bei
und die vielen anderen nur wenig bis
nichts. Zudem gibt es zahlreiche Tritt-
brettfahrer. Dennoch bricht die offene
Zusammenarbeit nicht ein“ (Seite 1.417).
Konsequenzen für HR-Management
Was heißt das nun für Personaler? Insge-
samt kann von einer breiten Gültigkeit
des Prinzips offener Zusammenarbeit
gesprochen werden. Sind Unternehmen
allerdings arbeitsteilig im tayloristi-
schen Sinn organisiert, mit weitgehend
isolierten Tätigkeitsfeldern, wird der
Charme von „Open Collaboration“ nicht
zur Geltung kommen. Nur dürfte dies
in zunehmend vernetzten Systemen im-
mer seltener der Fall sein.
Ganz klar, je größer der Anteil von
Kooperationsbereiten, desto besser wird
die Leistungsfähigkeit offener Zusam-
menarbeit. In Firmen ist dieser Anteil
unterschiedlich und kann verändert
werden, etwa durch die mittels Ein-
stellung und Beförderung beeinflusste
Egoismus-Altruismus-Verteilung der
Belegschaft. Außerdem können weitere
HR-Aktivitäten aus demBereich des Füh-
rungsverhaltens und der Anreizsysteme
die Kooperationsbereitschaft erhöhen.
Wobei das Vorleben von oben eine kaum
zu unterschätzende Vorbildwirkung in
der „Sharing Economy“ besitzt.
Die Studie aus Sicht der HR-Praxis
weitergedacht
Hinsichtlich ihres People-Managements
können Unternehmen mit „Open Col-
laboration“ recht locker umgehen. Die
erwähnten Maßnahmen zur Steigerung
des Anteils Kooperationsbereiter kön-
nen sogar nachteilige Effekte haben,
bringen zumindest kaum zusätzliche
Leistung. Offene Zusammenarbeit
klappt selbst mit einer kleinen Gruppe
von aktiven Altruisten und einer star-
ken Egoisten-Fraktion, so die Studie.
Erst bei Trittbrettfahrer-Anteilen von
über 70 Prozent kollabiert die offene Zu-
sammenarbeit, wenn sich fast alle nur
noch kostenlos bedienen möchten. Ein
bisschen Mitwirkung der großen Mehr-
heit bleibt schon erforderlich.
Unternehmen müssen sich viel eher
darüber beratschlagen, wie und wo ihr
Geschäftsmodell von außen herausgefor-
dert wird. Sie müssen erkennen, wenn
Menschen in offener Zusammenarbeit
konkurrierende Produkte erzeugen und
kostenlos zur Verfügung stellen, wofür
die Firma bislang abgerechnet hat.
MARTIN CLASSEN
führt seit
2010 sein Beratungsunter-
nehmen People Consulting.
DR. CHRISTIAN GÄRTNER
ist Assistenz-Professor an der
Universität der Bundeswehr
in Hamburg.
Vier Aspekte kennzeichnen offene Zu-
sammenarbeit („Open Collaboration“):
1. Menschen erzeugen Güter/Dienst-
leistungen mit ökonomischem Wert.
2. Es gibt (fast) keine Begrenzung hin-
sichtlich Nutzung und Erzeugung.
3. Interaktion und das Aufbauen auf
Beiträgen anderer sind zentral.
4. Zusammenarbeit erfolgt zielorien-
tiert, wird aber nur lose koordiniert.
KENNZEICHEN