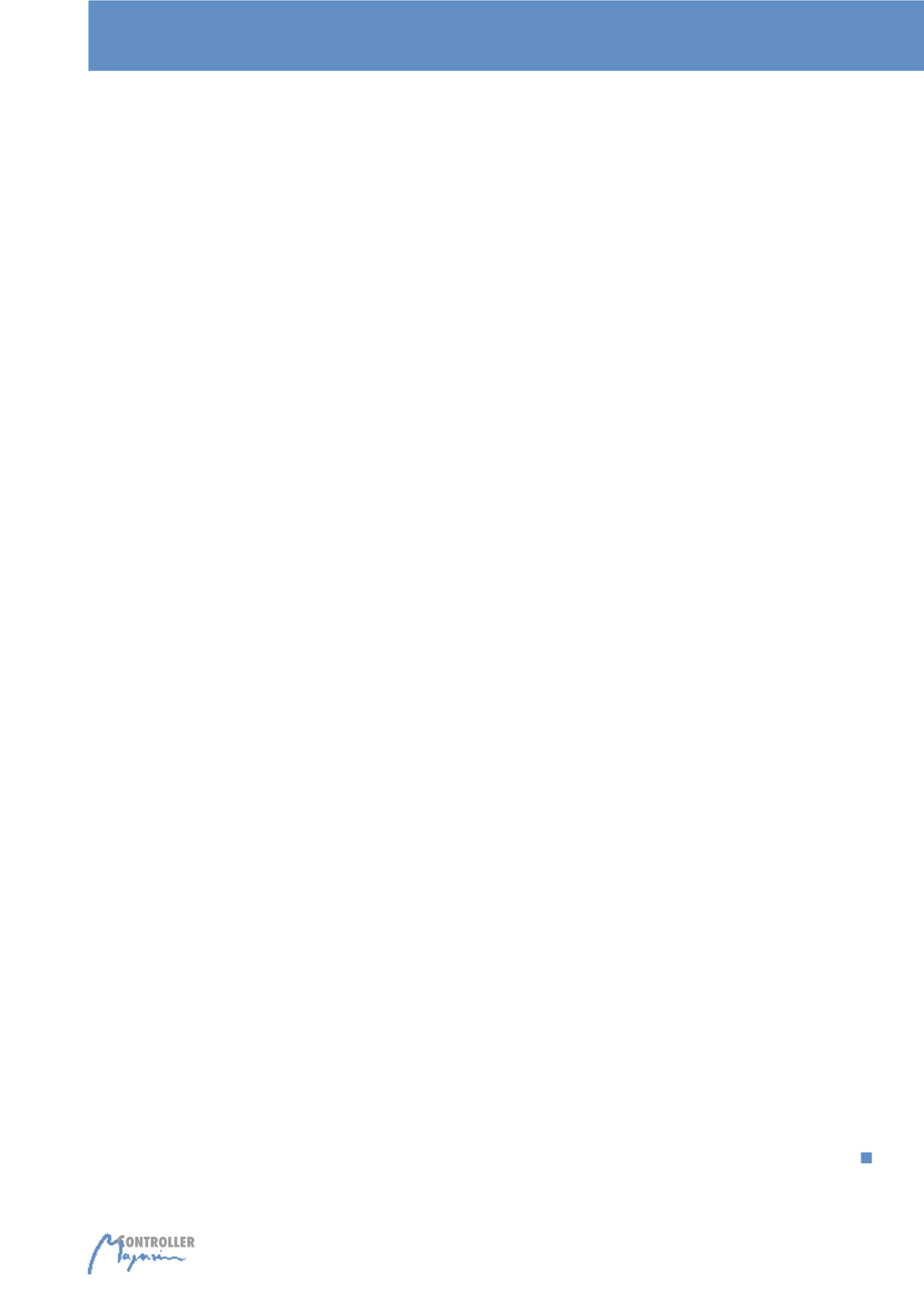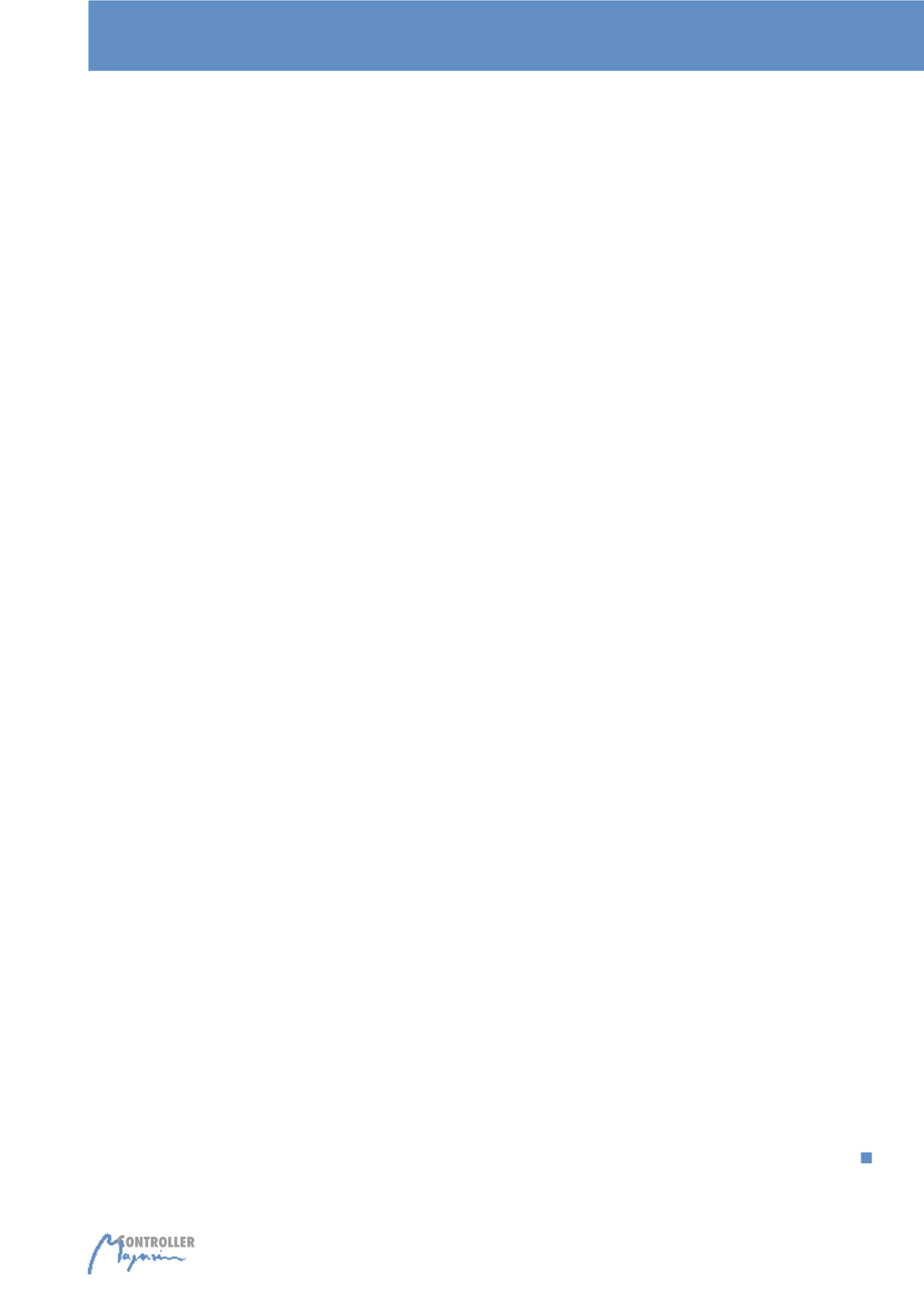
68
Analysen als Basis für konkrete Zielstellungen,
Planungen und Steuerungsmaßnahmen.
In den Debitoren findet ein Unternehmen für je-
den Kunden das Anfangsdatum der Geschäfts-
beziehung, die geleisteten Zahlungen und die
Einhaltung der Zahlungsziele (Zahlungsmoral).
Im Einzelhandel trifft das nur teilweise zu. Dort
sind die Kunden insoweit einzeln dokumentiert,
als sie durch identifizierbare elektronische Zah-
lungsmittel erfasst werden. Für einen weiteren
Teil der Kunden lassen sich Gruppen bilden, so-
fern geeignete Angaben aus einem CRM-Sys-
tem (z. B. Kundenkarte) vorhanden sind. Der
verbleibende Teil kann als Gruppe behandelt
werden. Sie bezahlt bar – d. h. die Zahlungs-
moral liegt bei 100%. Die Zahlungsintensität ist
am Volumen des Bargeldverkehrs ablesbar.
Und die Dauer der Geschäftsbeziehungen be-
ginnt mit der ersten Kassenabrechnung.
Die übrigen primären Stakeholder sind in den
Buchungsdaten des Einzelhandels wie bei allen
anderen Unternehmen erfasst. In den Kredito-
ren werden die analogen Daten für Lieferanten
und Kooperationspartner dokumentiert. Die
Personalkonten verzeichnen alle erforderlichen
Angaben für die festen und freien Mitarbeiter.
Die Informationen zu den Investoren werden in
den Kreditkonten erfasst und jene für die Ge-
sellschafter in den Gesellschafterkonten.
Werthaltigkeit und Geschäftsmodell
Welches Maß an Werthaltigkeit ein Unterneh-
men anstrebt, hängt von seinem Geschäftsmo-
dell und der Strategie ab.
·
Wer z. B. im Feld der TOP-Qualität mit Premi-
um-Preisen anbieten will, darf sich nicht nur
bei seinen Kunden um hohe Wertschätzung
bemühen. Es muss auch bereit und fähig
sein, die besten Mitarbeiter und Lieferanten
gewinnen, binden und bezahlen zu können.
Das Unternehmen muss also eine hohe
Werthaltigkeit zu all seinen direkten Stake-
holdern aufbauen.
·
Wer mit einem Geschäftsmodell erfolgreich
sein will, das eher auf niedrige Preise und
schnell wechselndes Personal im Niedriglohn-
Sektor setzt, muss eine andere Struktur der
Werthaltigkeit anstreben. Diese Struktur ist
nicht von vornherein besser oder schlechter
als die andere. Sie muss dem Geschäftsmo-
dell entsprechen. Das Geschäftsmodell und
seine Akzeptanz bildet das Kriterium für die
anzustrebende Struktur der Werthaltigkeit.
Das
Maß der wirtschaftlich gebotenen Wert-
haltigkeit
ist demnach abhängig von der Strate-
gie. Es bildet das Pendant, die Ergänzung zum
Maß des operativen Geschäfts – der Rentabili-
tät. Mit der Werthaltigkeit lassen sich die Ziele
der Strategie – im Kontext der Wirkungsstufen –
zu einem ökonomischen Maß (des Outflows) zu-
sammenführen: Mit den Zielen für die Rentabili-
tät wird ein Unternehmen demgegenüber auf die
Finanzierbarkeit der Strategie ausgerichtet.
Erst
Werthaltigkeit und Rentabilität zusammen
sind in der Lage, ein Geschäftsmodell be-
züglich der daran geknüpften wirtschaftli-
chen Erwartungen adäquat abzubilden.
Sie
müssen zueinander passen.
Fazit
Moderne Wertorientierung schließt das Ma-
nagement der Wirkungen aller Vermögensar-
ten
9
als ein wesentliches Element in sich ein.
Kein genutztes oder beeinflusstes Vermögen soll
übersehen werden. Die differenzierten Formen
an „Inputs“ gehen im Rahmen des Geschäfts-
modells in die Aktivitäten ein und gestalten die
internen und externen Wirkungen.
Ausgehend von der Gesamtsteuerung der
Werthaltigkeit (Wirkungsstufen-Modell) können
mit der Formulierung der Anforderungen an die
Entwicklung von Verhalten & Einstellung die dif-
ferenzierten Ziele für alle relevanten Stakehol-
der vereinbart werden. Dann kann die Zielerrei-
chung im Rücklauf auch konkret abgerechnet
werden. Die reale Entwicklung der Werthaltig-
keit zeigt schließlich, ob die Differenzierung der
Aufgabenstellung in die konkreten Ziele ausrei-
chend ist bzw. inwieweit sie nachjustiert wer-
den muss.
Gleichzeitig muss es immer darum gehen, die
Wirkungen auf die Werthaltigkeit in einer dyna-
mischen Balance zur Entwicklung der Rentabi-
lität zu halten. Deshalb sollte eine moderne
Wertorientierung immer beide Wirkungen im
Auge behalten. Das ist ein Anfang. Jedes Unter-
nehmen muss seine eigenen Lösungen finden.
Viele wirksame Ideen werden in der Praxis
schon umgesetzt. Wir haben die Chance, die-
sen Weg fortzusetzen.
Fußnoten
1
Der Beitrag ist teilweise dem im Rahmen der
ICV-Publikationsreihe erschienenen Leitfaden
„Moderne Wertorientierung“ entnommen.
2
Im IIRC sind neben großen Unternehmen aus
allen Wirtschaftsräumen der Erde und wichti-
gen Wirtschaftsprüfungs-Organisationen auch
die beiden bedeutendsten Standartsetter IASB
und FASB zusammengeschlossen. Es darf er-
wartet werden, dass das Framework in den
kommenden Jahren schrittweise in internatio-
nal verbindliche Regelwerke für das Integrated
Reporting umgesetzt wird.
3
Deutsche Übersetzung des Fachkreises „Con-
trolling & IFRS“ nach <IR>-Framework, De-
zember 2013 S. 13.
4
Dieser Begriff wurde im Fachkreis Kommuni-
kations-Controlling des Internationalen Control-
ler Vereins entwickelt.
5
Vgl. Storck, C. / Schmidt, W. (2009). Sonder-
stellung aufgeben. Pressesprecher 6 (5), 30-
32; Stobbe, R. et.al. (2010): Grundmodell für
Kommunikations-Controlling; Statement des
Internationalen Controller Verein,
controllerverein.com/Controller_Statements.
187.html; Storck, C. / Schmidt, W. (2014). In
zwölf Schritten zum Reputationsertrag. In Pres-
sesprecher 11 (7), 18-21..
6
z. B. Abgeordnete, Regierungsvertreter und Auf-
sichtsbehörden sowie Verbände, Körperschaften
und Lobbyisten (politische Akteure), aber auch
Sozialpartner wie Gewerkschaften oder Anwoh-
ner und Nichtregierungsorganisationen; vgl. auch
Freeman, R.E. (2010). Strategic Management: A
Stakeholder Approach. Cambridge, 45 f.
7
Vgl. Kleinhietpaß, G. / Hanken, J. (2014): Ver-
rechnungspreise, Haufe.
8
Mit zunehmender Dauer der offenen Posten
sinkt die verfügbare Werthaltigkeit der Ge-
schäftsbeziehungen, weil Zahlungen über diese
Zeitspanne ausbleiben.
9
„Vermögensarten“ entsprechen im Englischen
den „Capital-Kategorien“; vgl. Schmidt, W. et.
al. (2015): Moderne Wertorientierung, Haufe
(im Rahmen des Schriftenreihe des ICV)
Moderne Wertorientierung