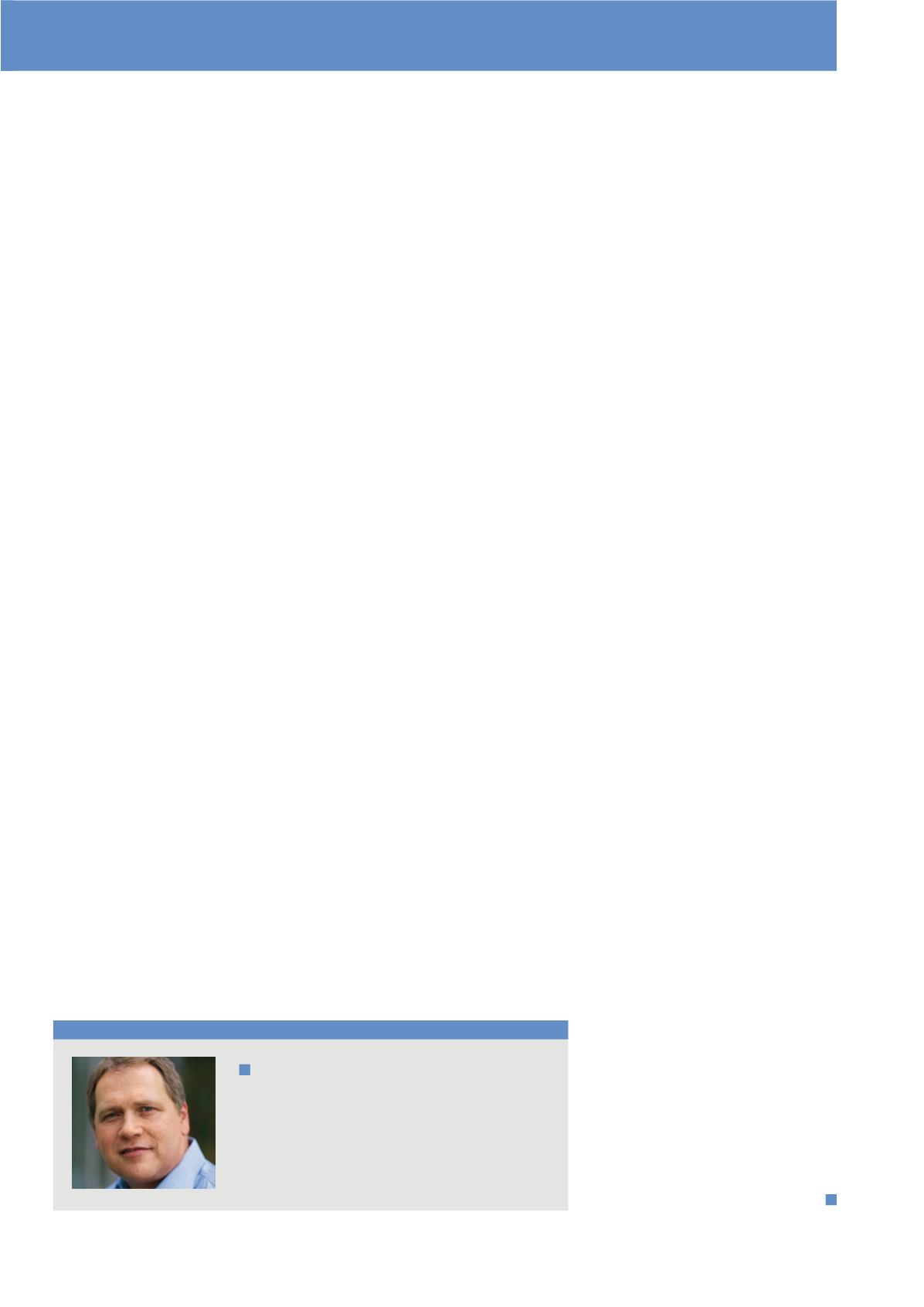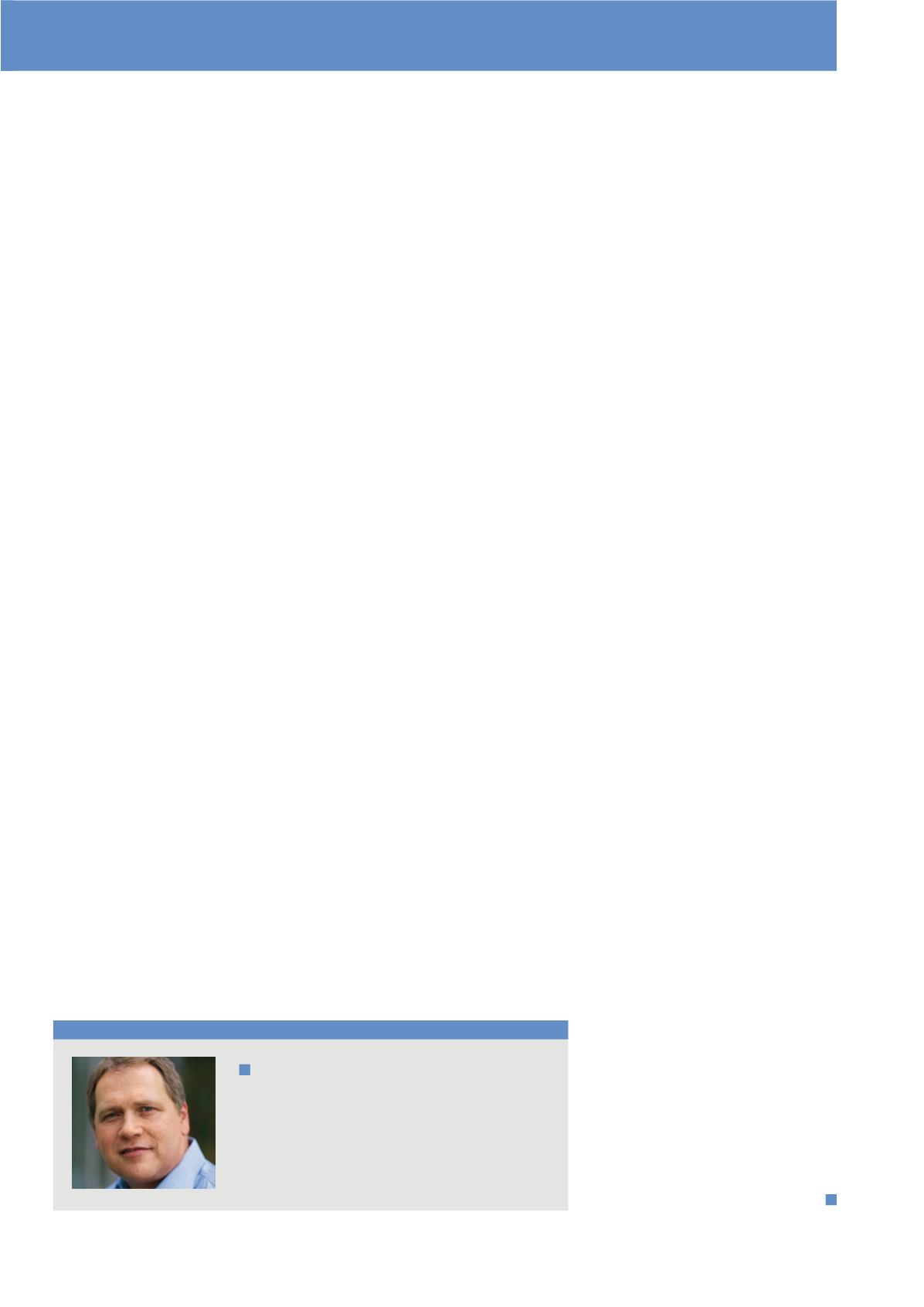
45
Der zweite Schritt ist die langwierige Suche
nach den Daten, die die Kriterien mit Leben fül-
len sollen. Dies führt vereinzelt zur Überarbei-
tung der Kriterien.
Eine vorhandene und ge-
lebte Balanced Scorecard liefert hier wert-
volle Informationen zur Verbesserung der
Daten.
Die Kandidatin präsentiert final auch konkrete
Ergebnisse, die das SEI geliefert hat. Überra-
schenderweise, auch für das Unternehmen,
hat man bei den C-Lieferanten meistens bes-
sere Ergebnisse erhalten wie bei dem einen
oder anderen A-Lieferanten (auf Basis einer
vorher angelegten ABC-Klassifizierung der
Lieferanten). Vielleicht liegt es daran, dass
die C-Lieferanten besser ins Geschäft kom-
men wollen, während sich die A-Lieferanten
sicher und eingerichtet wähnen? Jedenfalls
hat man in dem Unternehmen erste Themen
und auch Maßnahmen festgelegt, die noch
dieses Jahr gemeinsam mit dem jeweiligen
Lieferanten besprochen und angegangen
werden sollen.
Insgesamt zeigt sich das Management des Un-
ternehmens angetan von den Ergebnissen des
SEI-Projekts. Trotz der immensen Arbeit, die
dahinter steht, wird nun überlegt, wie man das
Konzept auch auf die anderen Produktkategori-
en übertragen kann. Unserer Kandidatin scheint
die Arbeit nicht auszugehen.
Aufbau eines Anti-Fraud-
Management-Systems
Unser Kandidat arbeitet für eine national und
international tätige Non-Profit-Organisation
(NPO), die in fast allen Ländern der Welt tätig
ist. Trotz des guten Ansinnens dieser Organi-
sation kann es schon mal passieren, dass auf
den einen oder anderen Mitarbeitenden weni-
ger Verlass ist: Es ist in mehreren Fällen, und
lange unentdeckt, Geld veruntreut und unter-
schlagen worden. Ein triftiger Grund, sich ei-
nerseits mit Fraud auseinanderzusetzen und
andererseits mit dem Thema „Internes Kon-
trollsystem (IKS)“ zu befassen, was zwar vor-
handen ist, allem Anschein nach aber unzurei-
chend funktioniert.
Tiefergehende Analysen unseres Kandidaten zu
den Fällen zeigen denn auch, dass es viel Ver-
trauen gibt (was als Kulturgut gilt), aber auch
gewisse „Unzulänglichkeiten“ in der internen
Organisation. So ...
·
... bietet Verantwortungsdiffusion ungewollt
Freiräume für dolose Handlungen an,
·
... liegt in kleineren Organisationseinheiten
die Verantwortung für die Buchhaltung,
die Bankverwaltung und Prüfung in einer
einzigen Hand (Personalkosten!),
·
... brauchen Abschlüsse, bedingt durch
die internationale Ausrichtung der NPO,
quasi „ewig“.
Das von unserem Kandidaten gestartete Pro-
jekt setzt sich deshalb folgende Ziele:
·
Erarbeitung von Maßnahmen und Vorschlä-
gen zur organisatorischen Neugestaltung
von Ablauf- und Abstimmungsprozessen,
so dass zukünftig dolose Handlungen mög-
lichst verhindert werden.
·
Aufbau eines Schulungskonzepts national
und international.
·
Entwicklung von qualitativen und quantitati-
ven Messgrößen für ein neues Anti-Fraud-
Management-System zur Überwachung der
veränderten Prozesse
·
Verschärfung der Compliance-Regeln.
·
Zeitliche Straffung der Berichtsfenster, vor
allem aus dem Ausland nach Deutschland.
·
Softwaregestützte Auswertungen,
Verprobungen und Analysen bei den
(internationalen) Finanztransaktionen.
Obwohl sich viele Mitglieder der Organisation
von den Vorfällen betroffen zeigen, eckt unser
Kandidat mit seinem Projekt schnell an. Ver-
schärfte Kontrollen, neue Richtlinien zum
Zahlungsverkehr usw. würden eben nicht in
die „offene Kultur“ des Unternehmens passen.
Unser Kandidat muss also viel Überzeugungs-
arbeit leisten, um sein Projekt zu starten und
vor allem am Laufen zu halten.
Zum Zeitpunkt unserer Präsentation hier in
Feldafing zeigt sich unser Kandidat überwie-
gend zufrieden mit den erzielten Ergebnissen
des Projekts. Mitarbeitende der Internen Revi-
sion sind z. B. in den letzten beiden Jahren ver-
mehrt in den Auslandsbüros der NPO gewesen.
Personen die mit (Bar-)Geld in Berührung kom-
men (können), müssen sowohl an Schulungen
(Abläufe und Compliance-Regeln) teilnehmen,
als auch nach den Schulungen unterschreiben,
dass sie entsprechend geschult worden sind.
Als schwierig erweist sich immer wieder noch
die Zusammenarbeit mit ausländischen Ban-
ken, die die von der NPO eingeforderten Sal-
denbestätigungen häufig deutlich später,
manchmal auch gar nicht, liefern. Die entspre-
chenden Istwerte zu den Ziel-Kennzahlen sind
in der Präsentation dunkelrot gehalten. Die
softwaregestützten Prüfungen werden ange-
wandt, bedürfen aber noch der einen oder an-
deren Verfeinerung.
Auch wenn das Projekt formal beendet ist, ge-
wisse Nacharbeiten und Verbesserungen wer-
den immer noch durchgeführt. Zumindest sind
seit den durch das Projekt initiierten Verände-
rungen keine neuen dolosen Handlungen be-
kannt geworden – womit das übergeordnete
Ziel zweifelsfrei erreicht ist.
Damit endet die inzwischen zwölfte Master
Class. Mein Dank geht wieder an unsere Kandi-
daten für ihre intensive Arbeit und die toll er-
brachte Leistung, sowie an die Beiräte für ihre
Mitarbeit und Würdigung der Arbeiten.
Für die Durchführung im November 2015 haben
sich bereits wieder einige neue Interessenten bei
uns gemeldet. Es sind spannende neue Themen
darunter, die zeigen, dass die Controllerarbeit
äußerst facettenreich ist. Details werden Sie in
einem Jahr, also im nächsten Bericht zur Master
Class, an dieser Stelle wieder lesen können.
Autor
Dipl.-Kfm. Prof. Detlev R. Zillmer
studierte Feinwerktechnik u. BWL an der TU Stuttgart. Seit 1992
ist er Trainer, seit 1994 Partner der CA Akademie. Im März 2003
wurde er zum Professor der Zürcher Fachhochschule ernannt.
Prof. Zillmer begleitet Firmen bei der Umsetzung von Projekten,
coacht Teams und Einzelpersonen, hilft beim Aufbau und Um-
setzen von Strategien, Projekt- und Personal-Controlling.
E-Mail:
CM Mai / Juni 2015