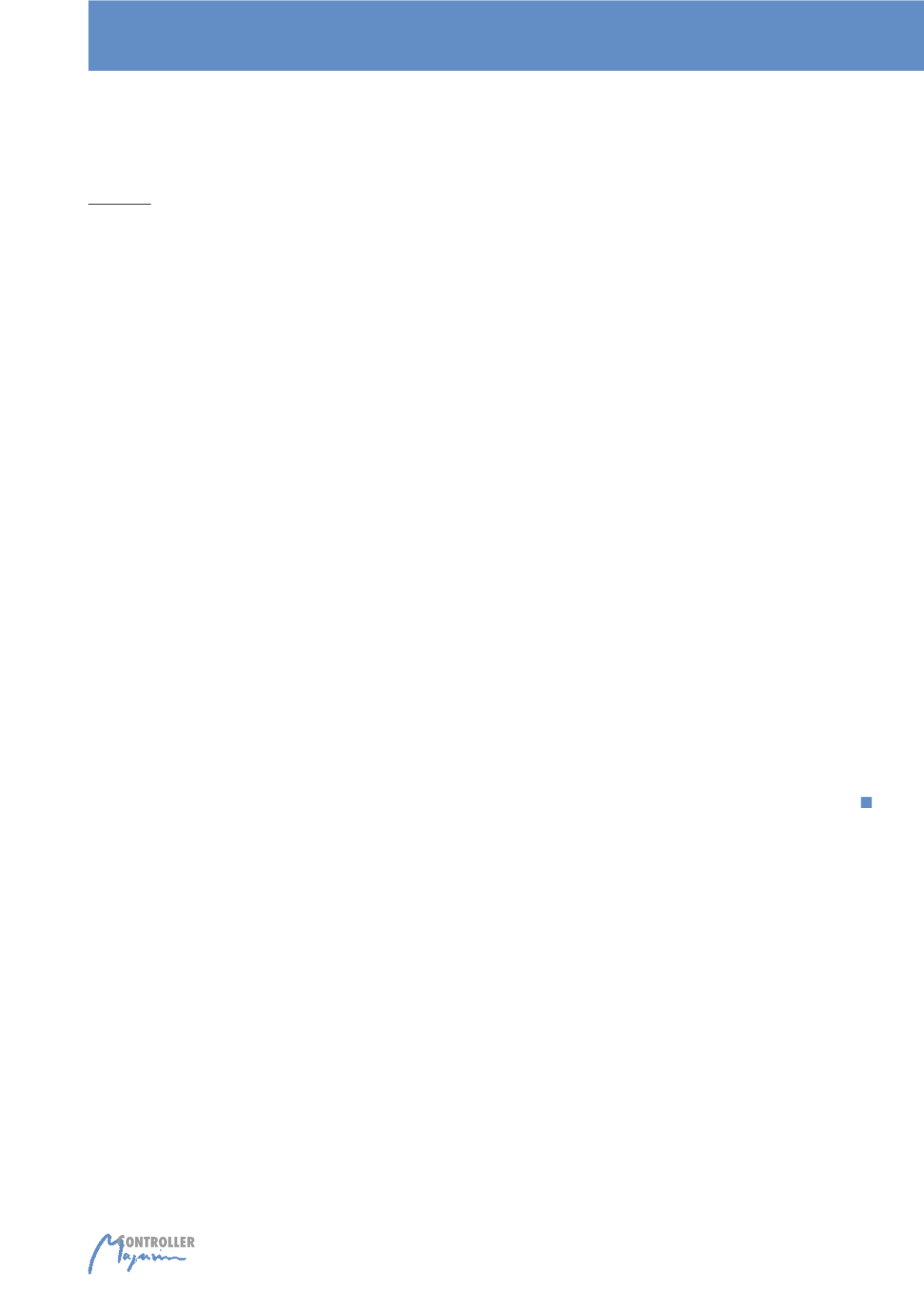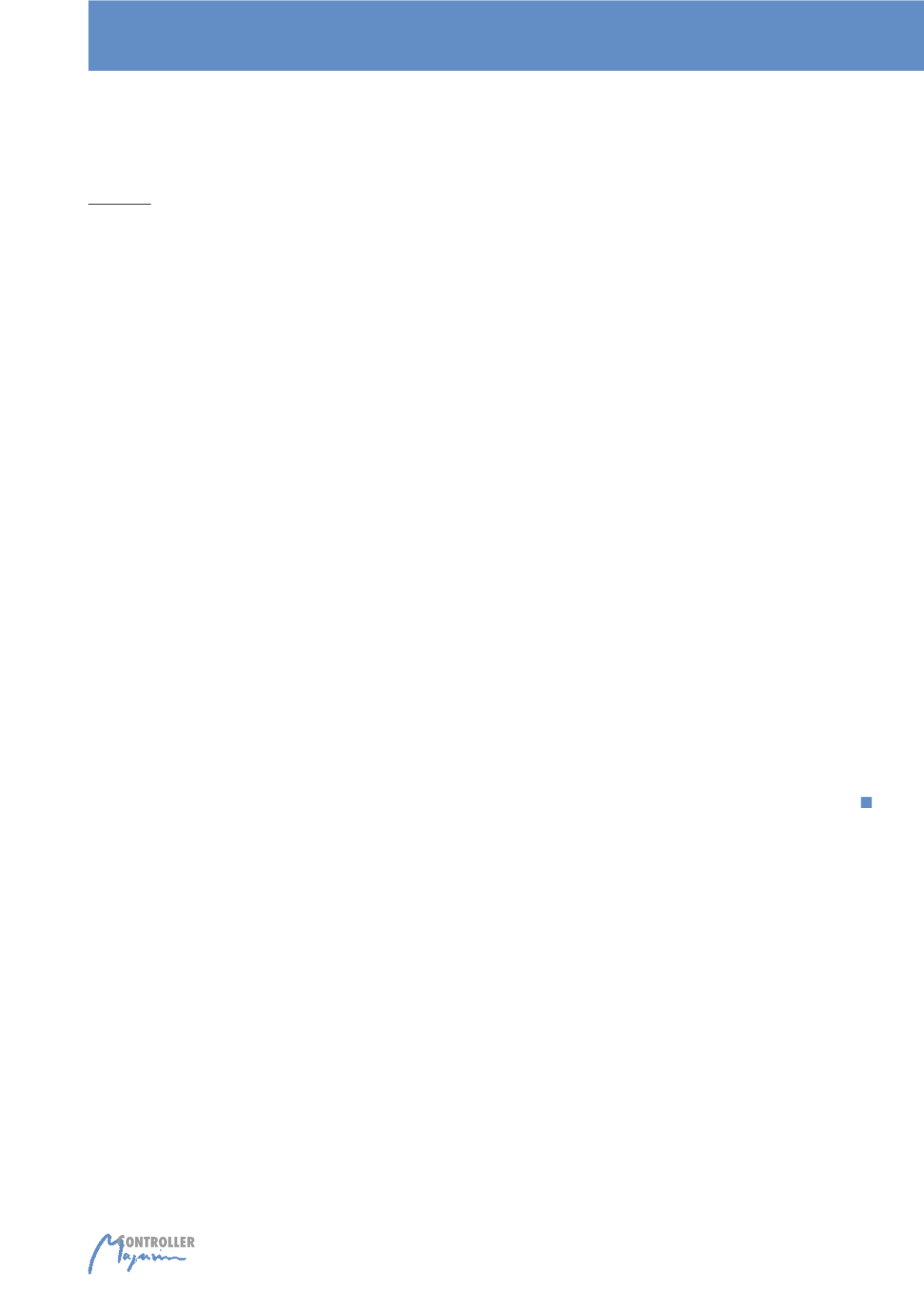
86
schaftlich richtige Führungsgrößen zu defi-
nieren
, deren Optimierung langfristig ange-
strebt werden muss.
Literatur
Brealey, R., Myers, S., Allen, F.: Principles of
Corporate Finance, Global Edition, 12. Edition,
McGraw-Hill 2016.
Hoberg, P. (2007): BWL in der Praxis: Wie gut
arbeiten Makler? - Ein Prinzipal-Agenten-Prob-
lem, in: WiSt 10/2007, S. 531-535.
Hoberg, P. (2010): Fallstudie: Konjunkturbele-
bung durch erhöhte Abschreibungssätze, in
Wisu 4/2010, 40. Jg., S. 543-545.
Hoberg, P. (2014): Vom externen Rechnungs-
wesen zur betriebswirtschaftlichen Wahrheit,
in: Der Betrieb, Nr. 11/2014, 67. Jg., S. 553-
560.
Hoberg, P. (2016): Lufthansa - Pilotenstreik
durch Missverständnisse im Controlling? in:
T-online vom 6.12.2016: Jeder zweite Opel ist
eine Eigenzulassung, in:
de/auto/news/id_79744978/neuzulassungen-
jeder-zweite-opel-ist-eine-eigenzulassung.html,
Abruf am 7.12.2016.
Wöhe, G., Döring, U., Brösel, G.: Einführung in
die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 26.
Überarbeitete und aktualisierte Auflage, Mün-
chen 2016.
Gewinne nach oben zu treiben. Auch sollten die
Zielerreichungen mit denen der Branche ver-
glichen werden.
Ergänzung des externen
Rechnungswesens
Der Hauptansatz muss jedoch in der Ergänzung
des externen Rechnungswesens durch Zusatz-
informationen liegen.
Es muss der Übergang
geschaffte werden vom externen Rech-
nungswesen zu betriebswirtschaftlich zu-
treffenden Daten
(vgl. Hoberg, P. (2014), S.
553 ff.). In welchem Umfang diese extrem
wichtigen Zusatzinformationen veröffentlicht
werden, muss in jeder einzelnen Situation ge-
klärt werden. Auf jedem Fall muss der Auf-
sichtsrat bzw. der Board of Directors überprü-
fen, wie sich der Wert nicht aktivierter Wirt-
schaftsgüter entwickelt hat. Insbesondere bei
den Markenwerten sind die Erhöhungen und
die Reduktionen der Werte zu dokumentieren.
Es darf nicht sein, dass z. B. bei Coca-Cola die
wichtigsten Wirtschaftsgüter – nämlich die
Marken – nur unzureichend in ihrer Wertent-
wicklung erfasst werden.
Schlussfolgerung
Die Principal-Agent-Theorie ist bis jetzt haupt-
sächlich für die Ergebnisse einer Periode un-
tersucht worden, wobei durchaus auch mehr-
jährige Zielgrößen vorgeschlagen werden.
Wenn die Probleme jedoch dynamisch – also
für eine Abfolge von Perioden – betrachtet
werden, zeigen sich
große Probleme in der
Abstimmung der Interessen zwischen den
Eigenkapitalgebern als Principals und den
beauftragten Managern als Agents.
Auch
aufgrund des Drucks von außen verhalten sich
Manager aus Eigeninteresse nicht selten an-
ders als es für die Eigenkapitalgeber gut wäre.
Möglich werden die Abweichungen auch durch
die Schwächen des externen Rechnungswe-
sens, in dem z. B. selbst geschaffene Marken-
werte nicht aktiviert werden dürfen. Für Firmen
wie Coca-Cola heißt dies, dass die wichtigsten
Wirtschaftsgüter gar nicht in den offiziellen
Büchern auftauchen. Dem Missbrauch ist Tür
und Tor geöffnet.
Das Controlling in den Un-
ternehmen ist dann gefragt, betriebswirt-
genüber der Management-orientierten Strate-
gie (Barwert 272,5). Die Unterscheidung zwi-
schen der Management-orientierten vs. der
Aktionär-zentrierten Vorgehensweise hatte in
Abbildung 3 in der Phase 1 begonnen. Zu Recht
könnte man einwenden, dass die sich anbah-
nende Krise schon vorher hätte bekämpft wer-
den müssen. Denn je früher mit der Korrektur
begonnen wird, umso leichter lassen sich Kri-
sen bewältigen. Daher sei jetzt angenommen,
dass schon in der Phase 0 eingegriffen wird.
Der Gewinn im Beispiel für die Phase 0 ist dann
deutlich niedriger: 20 GE (Spalte 4) vs. 100 GE
(Spalte 1) in der Management-orientierten Vor-
gehensweise. Aber dafür erholt sich der Gewinn
viel schneller, weil leichter und früher gegenge-
steuert werden konnte.
Allerdings stellt sich wieder die berechtigte
Frage, ob der ehrliche Manager in Phase 0
überleben würde. Denn die Eigenkapitalgeber
können angesichts des Ergebnisrückgangs nur
schwer beurteilen, ob die Ursache des Rück-
gangs in einem schwachen oder in einem ehr-
lichen Management liegt.
Hilfe durch externe Branchenexperten
Wenn es zum Austausch des alten Manage-
ments kommt, empfiehlt sich die Schaffung
eines externen Kreises (z. B. Beirat), welcher
beratend bei Krisenmaßnahmen mitwirkt und
damit Übertreibungen entgegenwirkt. Wichtig
ist es, dass einige Mitglieder eine tiefe Bran-
chenkenntnis besitzen, so dass sie sich ein fun-
diertes Urteil erlauben können. Im Weiteren
kann die Principal-Agent-Problematik dadurch
entschärft werden, dass die Manager langfris-
tige Ziele erhalten, so dass die Manipulationen
ab Phase 4 keine Vorteile bringen würden. Eine
Variante bestünde darin, in Phase 4 Optionen
oder verzögerte Boni mit dem zukünftigen Akti-
enkurs als Basis zur Bestimmung der Leis-
tungsprämien zu verwenden. Diese dürften
aber erst viel später (z. B. nach 5 Jahren) einge-
löst werden können. Im Beispiel wären sie dann
wertlos, weil der Aktienkurs durch den Gewin-
neinbruch dramatisch sinken würde. Auch
mehrjährige Ziele wären vernünftig, indem z. B.
die Summe der Gewinne der nächsten 5 Jahre
die Basis für Boni bilden würde. Das würde die
Manager sicherlich bremsen, kurzfristig die
Teuflischer Zyklus gegen Aktionäre