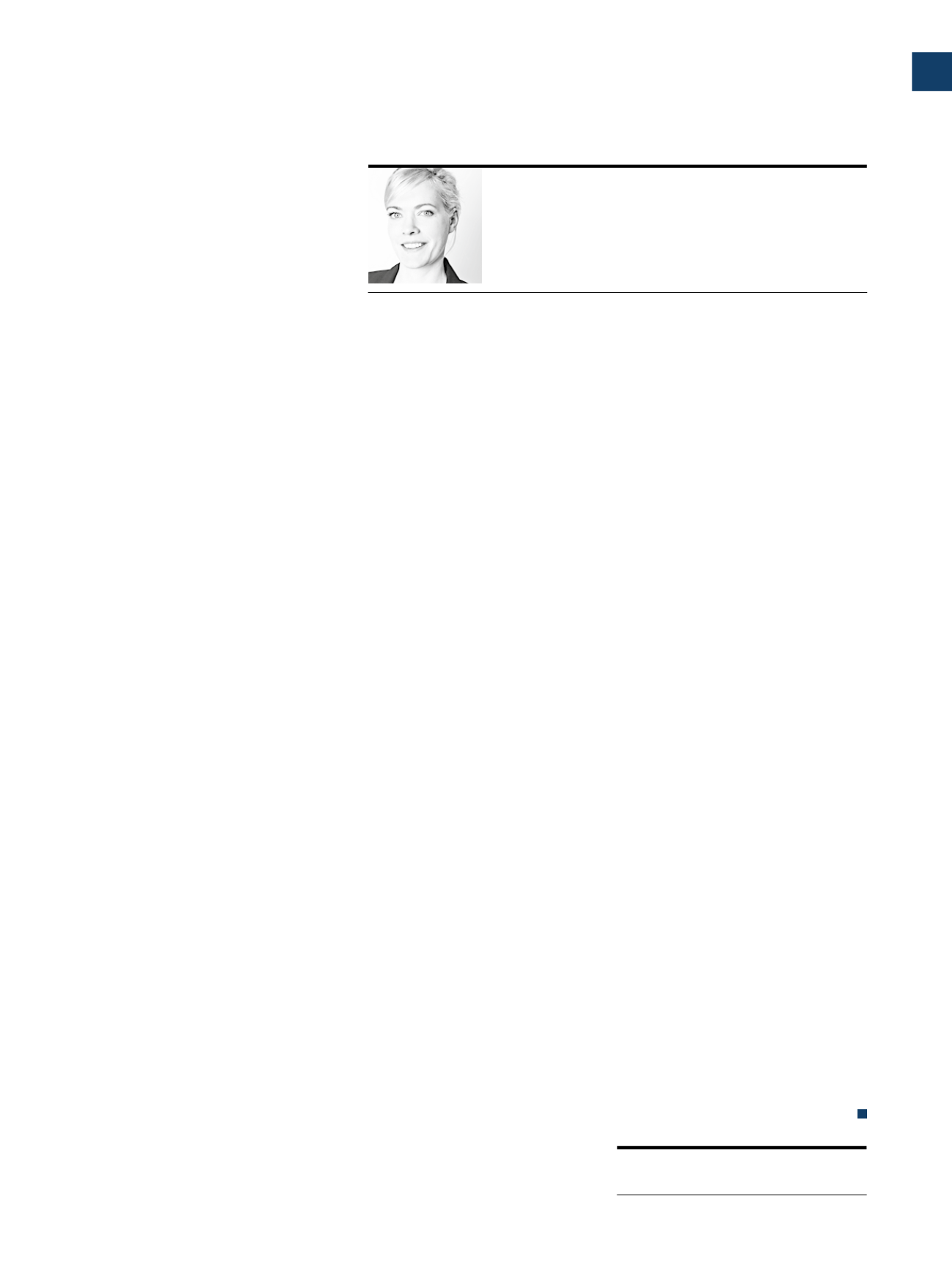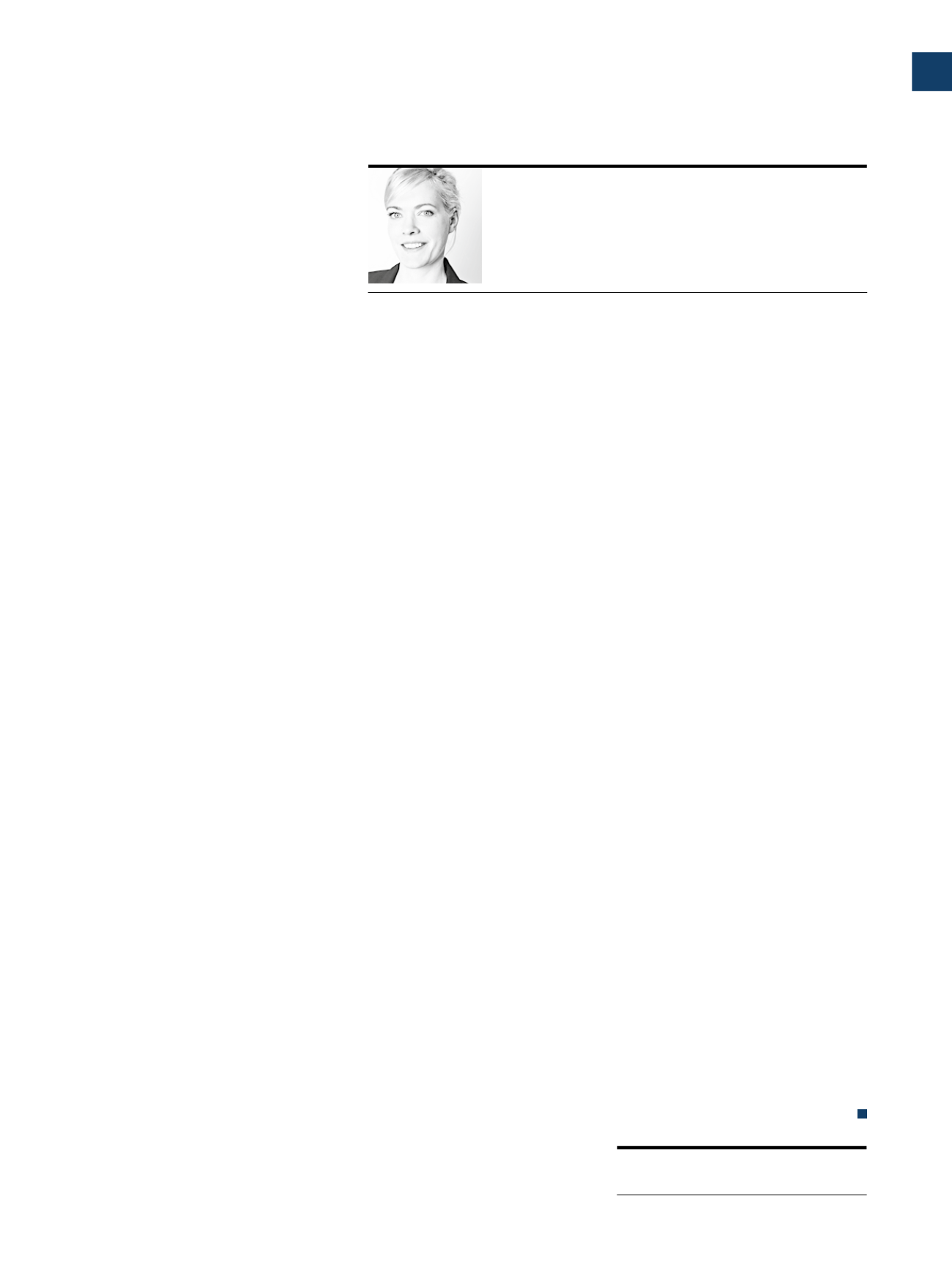
37
06/18 personalmagazin
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
ment“, betont Patricia Heufers. „Wir
wollen leistungsstarke Mitarbeiter ge-
winnen. Und deshalb schauen wir auf
die Stärken und nicht auf die Defizite
der Kandidaten.“ Diesmal sitzen zehn
Studierende zusammen. Ihre Fächer:
BWL und Verkehrsökonomie, Sprachen
und Jura, Verkehrswirtschaft und Fi-
nanzwissenschaft. Der Physiker in der
Runde gibt noch vor dem Sommer sei-
ne Dissertation ab und wird als Postdoc
für ein Forschungsjahr nach Bordeaux
gehen. Eine Studierende des internatio-
nalen Managements, die eingeschränkt
sieht und hört, arbeitet bereits in einem
kleinen Beratungsteam, ein BWLer hat
Berufspraxis als Touristikassistent. „Wir
schließen kein Fach aus“, sagt Heufers.
„Vielfalt ist für uns nicht nur Herausfor-
derung, sie bringt auch klare Vorteile.“
Behinderung im Lebenslauf einfügen
Studierende, die den Sprung zu EY
schaffen wollen, starten mit einer On-
line-Bewerbung, müssen Prescreening,
Telefonate, persönliche Gespräche und
einen Business Case bewältigen – dann
kommt das Angebot. Wer heute im
Workshop sitzt, konnte seine Bewer-
bungsunterlagen vorher einreichen. In
zwei Gruppen werden die Unterlagen
bewertet: Rechtschreibefehler gehen gar
nicht, beim Lebenslauf muss man auf
den Punkt kommen, das Anschreiben
soll auf die Firma bezogen sein. So weit,
so bekannt.
Doch an welcher Stelle erwähnt der
Bewerber, dass er sehbehindert oder
blind ist? Dafür gibt es kein Patentre-
zept. Aber Firmenwebseiten verraten
oft, ob Diversity gelebt wird. Kritisch ist
es, sich die Überraschung fürs Bewer-
bungsgespräch aufzuheben, meinen die
Profis. Denn die Personaler könnten sich
betrogen fühlen. Ein Merkblatt über die
Fähigkeiten von blinden Mitarbeitern
wiederum ist der Tick zu viel und wirkt
wie Besserwisserei. Die entscheidende
Frage lautet: Wie viel Einfluss hat mei-
ne Behinderung auf meinen Job? In-
klusionsaktivist Raul Krauthausen hat
seinem Buch nicht umsonst den Titel
gegeben: „Dachdecker wollte ich eh
nicht werden“. Aber für einen blinden
Wirtschaftsprüfer sind heute genug
technische Hilfsmittel auf dem Markt.
Und weil Einstellungsgespräche keine
Allerweltssituationen sind, herrscht im
Workshop bei der Simulation eines In-
terviews neugierige Stille.
Technische Ausstattung ist wichtig
Zweifler am technischen Fortschritt
können im Workshop einiges lernen:
größere Bildschirme, Sprachfunktionen
von Smartphones, der PC als Telefon,
Headset, Brailledrucker, Voicemailrea-
der statt Powerpoint als Vortragsstütze.
Die Studierenden kennen das alles. Die
Empfehlung des EY-Teams: Im Bewer-
bungsgespräch das I-Phone bedienen,
ein Diagramm schreiben oder ein lö-
sungsorientiertes Excel-Sheet – solche
praktische Nachhilfe löst oft die ver-
klemmte Stimmung, die aus der Unsi-
cherheit der Sehenden entsteht.
Viele Firmen erfüllen nicht die ge-
setzlich vorgegebene Quote für die Be-
schäftigung behinderter Menschen. Sie
bezahlen die Ausgleichsabgabe von 125
bis 320 Euro pro nicht besetztem Pflicht-
platz. 564 Millionen Euro gingen 2016
an die Integrationsämter. Die finanzie-
ren davon zum Beispiel das Einrichten
barrierefreier Arbeitsplätze oder den
Umbau in solche. Ein weiterer Teil der
Ausgleichsabgabe geht an die Bundes-
agentur für Arbeit, die daraus Einglie-
derungszuschüsse an Arbeitgeber zahlt.
Es gibt Geld und Wege, aber nicht im-
mer den Willen, behinderte Menschen
zu beschäftigen. „Die Welt wartet nun
mal nicht auf uns“, kommentiert Mi-
chael Ritter mitleidlos das praktische
Arbeitsleben, „aber das ist auch okay.“
Und zu EY: „Bei uns gibt es keine spezi-
ellen Jobs für Behinderte.“ Kein Teilneh-
mer protestiert, alle lauschen gespannt.
Denn der EY-Berater für forensische
IT-Themen, der im Laufe seines Berufs-
lebens erblindete, erzählt auch, wie er
arbeitet. „Ich überlege ganz realistisch,
ob ich das leisten kann, und bespreche
dann mit meinem Kunden oder Kolle-
gen, wie wir das hinbekommen.“ Ein
Auftrag in Toronto ist ihm lieber als ei-
ner in Eppstein, wo es schwierig ist, ein
Taxi zu kriegen. Und er weiß, dass ihm
viele Leute unsicher begegnen. Noch ist
es nicht in allen Köpfen angekommen,
dass blinde Menschen anspruchsvolle
Jobs übernehmen. Einem der studieren-
den Teilnehmer wurde in der Jobagentur
empfohlen, Telefonist zu werden. Empö-
rung darüber mag im ersten Moment die
Psyche entlasten, langfristig bringt es
aber mehr, auf seine Stärken zu setzen.
„Blindsein ist eines meiner Persönlich-
keitsmerkmale, durch das ich mich nicht
defizitär fühle“, sagt Michael Ritter.
Mitarbeiter und Job matchen
Damit liegt er bei EY auf Linie: Für je-
den Mitarbeiter müssen die geeigneten
Tätigkeiten gefunden werden in dieser
Hochleistungsberatung. Was für die Psy-
chologin Dietze der Trainingsbereich in
HR ist, kann für andere das Wirtschafts-
prüfungsteam oder die IT sein. „Uns hat
ein Teilnehmer gesagt, er hätte sogar
bezahlt, weil sich der Workshop mittags
schon gelohnt habe, aber das machen
wir nicht“, erzählt Patricia Heufers von
einem dicken Lob. Und kündigt für den
Herbst den dritten „Blind in Business“-
Workshop an. Wieder wird er kostenlos
sein – inklusive der Anreise.
RUTH LEMMER
ist freie Journalistin in
Duisburg.
„Für uns ist der Workshop ein klares
Recruiting-Instrument. Wir schauen auf
die Stärken der blinden Bewerber.“
Patricia Heufers, Diversity-Expertin der Unternehmensberatung EY