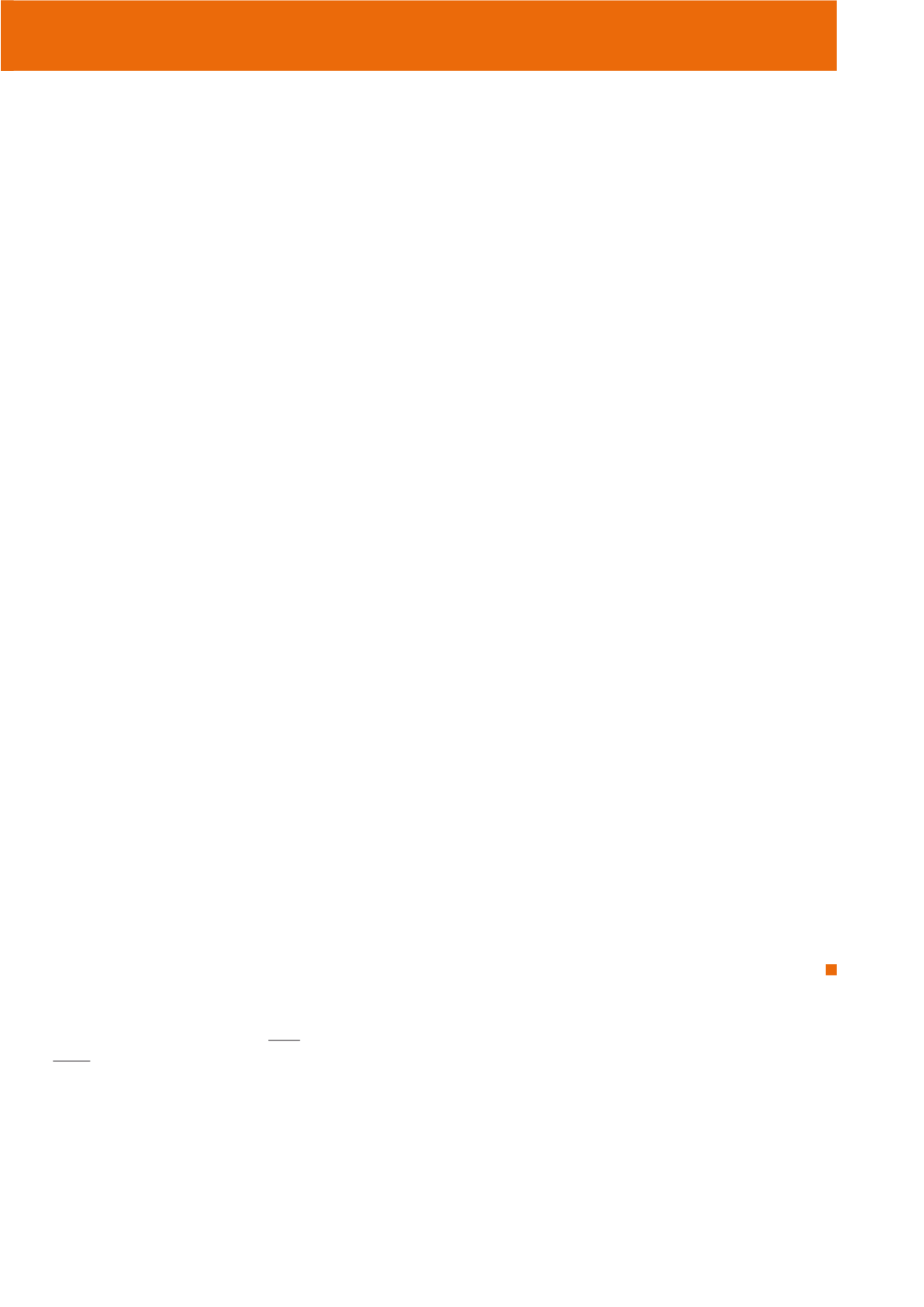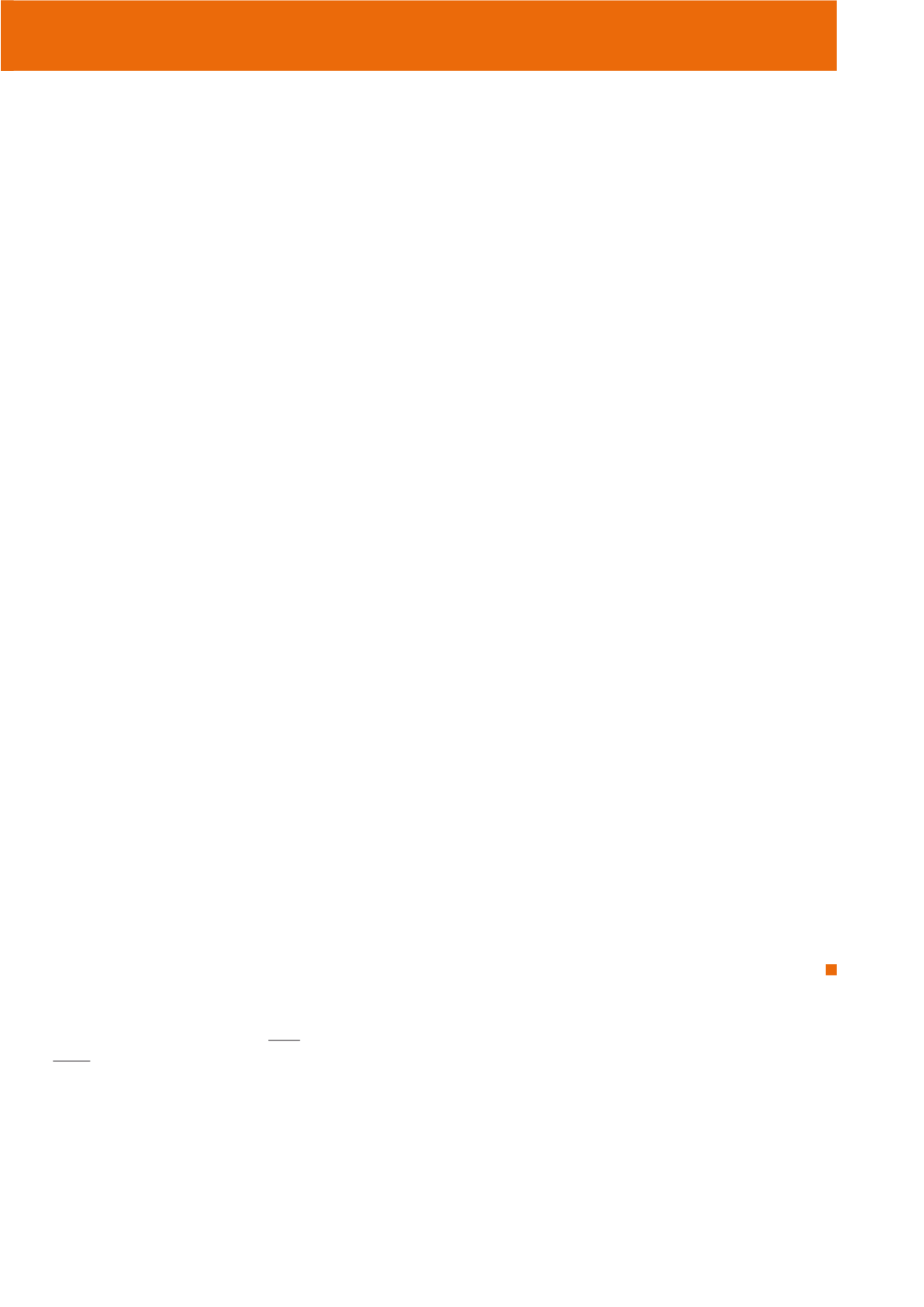
87
nes Fahrzeug können diese gar sinken oder
konstant bleiben.
Mehrbedarf kann auch noch aus einer Reihe
von weiteren Themen, die nicht direkt zuorden-
bar sind, entstehen. Die Variable
z
fasst die
Budgets für Sonderthemen zusammen. Darun-
ter kann man Themen wie Änderungen gesetz-
licher Vorgaben, Organisationsänderungen im
Unternehmen aber auch Bestandsveränderun-
gen erfassen. Die Bestandsveränderungen (Er-
höhung oder Reduktion) können mit einem
durchschnittlichen Jahreskostensatz pro Fahr-
zeug bewertet werden.
Die Prognoserechnung kann auch für einen
längeren Zeitraum (3-5 Jahre) durchgeführt
werden. Absprungbasis bilden dabei jeweils die
geschätzten/berechneten Kosten der Vorperio-
de. Allerdings ist zu beachten, dass mit zuneh-
mender Jahresanzahl die Genauigkeit abnimmt
und die Ergebnisse unbelastbarer werden. Die
richtige Annahme der Preissteigerungen ist da-
bei entscheidend. Sinnvoll ist es dennoch,
wenn ein gesamthafter Trend über einen länge-
ren Zeitraum erwünscht ist.
Reporting und Monitoring
Die Einführung eines
unterjährigen Reporting
für Kosten/Kostenbestandteile, Bestandsverän-
derungen sowie weitere Kennzahlen schafft
Transparenz und die Grundlage für eine optima-
le unterjährige Steuerung. Daraus sind Abwei-
chungen und Tendenzen zu erkennen, woraus
sich
Gegensteuerungsmaßnahmen ableiten
lassen. Aus praktischen Gesichtspunkten und
wegen eines geringen administrativen Auf-
wandes empfiehlt es sich das Reporting mit
MS Office Produkten aufzubauen. Stehen die
Grunddaten beispielsweise in Excel-Form zu
Verfügung, lassen sich hieraus entsprechende
Präsentationen mit grafischen Elementen er-
stellen. Eine beispielhafte Darstellung ist Abbil-
dung 5 zu entnehmen.
Die Darstellung bündelt die wesentlichen Infor-
mationen und eignet sich als Management-
Präsentation. Der entscheidende Vorteil ist,
dass durch die lineare Hochrechnung der Ist-
Kosten eine Prognose zum Jahresende erstellt
werden kann. So lässt sich eine Aussage tä-
tigen, ob das geplante Jahresbudget über-
schritten wird.
Weiterhin ist anhand des monatlichen Zyklus
früh eine mögliche Planüberschreitung er-
kennbar
, die durch Gegensteuerungsmaßnah-
men verringert werden kann.
Der Reportingzyklus kann auch quartalsweise
erfolgen. Je nach Datenbasis und Detailie-
rungsgrad kann das Reporting auf Unterneh-
mens-/Bereichs- oder Kostenstellenebene auf-
gebaut werden. Benötigt man weitere relevante
Kennzahlen, kann das Layout entsprechend an-
gepasst werden.
Fazit
Eine gesamthafte Erfassung und Systematisie-
rung der Fuhrparkkosten nach Kostenkompo-
nenten bildet die Grundlage für die Budgetpla-
nung der Zukunft. Durch Anwendung eines
Prognosemodells lassen sich unterschiedliche
Budgetszenarien für zukünftige Perioden simu-
lieren. Entscheidend dabei sind die Betrachtung
von Preissteigerungen/Änderungen einzelner
Kostenkomponenten aus der Vergangenheit so-
wie mögliche Optimierungsansätze. Weiterhin
sollte das Fuhrparkmanagement als Unterstüt-
zungsfunktion für das operative Geschäft ange-
sehen werden, indem die Verfügbarkeit der
Flotte und die notwendige Mobilität der Mitar-
beiter sichergestellt ist. Gerade Lastspitzen
können hierbei durch Carsharing unkompliziert
ausgeglichen werden.
Letztendlich ist abzuwägen, wie viel Ressour-
cen und Zeit in das Thema Fuhrpark und Fuhr-
parkkosten investiert werden sollen. Fällt der
Kostenblock unter betrachtungsrelevante Auf-
wandspositionen des Unternehmens, ist eine
nähere Betrachtung sinnvoll. Stehen andere
Themen und Aufwandspositionen im Vorder-
grund, sind der Aufwand und der Nutzen ge-
genüberzustellen.
Fußnoten
1
Vgl. Rieger, Michael (2003): Kosten sparen
durch innovatives Fuhrparkmanagement, Auto
Business Verlag, Ottobrunn, S. 20.
2
Quelle: Eigene Darstellung; die dargestellte
Systematisierung ist nicht zwingend zu verwen-
den, eine andere Klassifizierung ist ebenfalls
möglich.
3
Vgl. Stenner, Frank (Hrsg.) (2010): Handbuch
Automobilbanken, Springer Verlag Heidelberg,
S. 86.
4
Vgl. u. a. Pätz, Helmut (2002): Das Fuhrpark-
management- und Leasing-ABC, Modautal, S. 6.
5
Vgl. Flottenmanagement, Ausgabe 4/2013,
12. Jahrgang, S. 46-47.
6
Vgl. u. a. Pätz, Helmut (2002): Das Fuhrpark-
management- und Leasing-ABC, Modautal,
S. 9. und S. 13.
7
Unter Carsharing versteht man die organisier-
te Nutzung eines Kraftfahrzeuges durch meh-
rere Fahrer. Das Fahrzeug wird für den ge-
wünschten Zeitraum über ein Buchungssystem
reserviert und steht dem Nutzer zur Verfügung.
8
Vgl. u. a. Bundesverband CarSharing (2010):
CarSharing für gewerbliche Kunden, Hannover,
S.5-6.
9
Quelle: Eigene Darstellung
10
Quelle: Eigene Darstellung, fiktives Zahlen-
beispiel
11
Die Preise für Rohöl sind stark von Spekulati-
onsblasen, politischen Entwicklungen, Krisen
und der Nachfrage abhängig. Quelle:
14
Eigene Darstellung; fiktives Zahlenbei-
spiel
CM Juli / August 2015