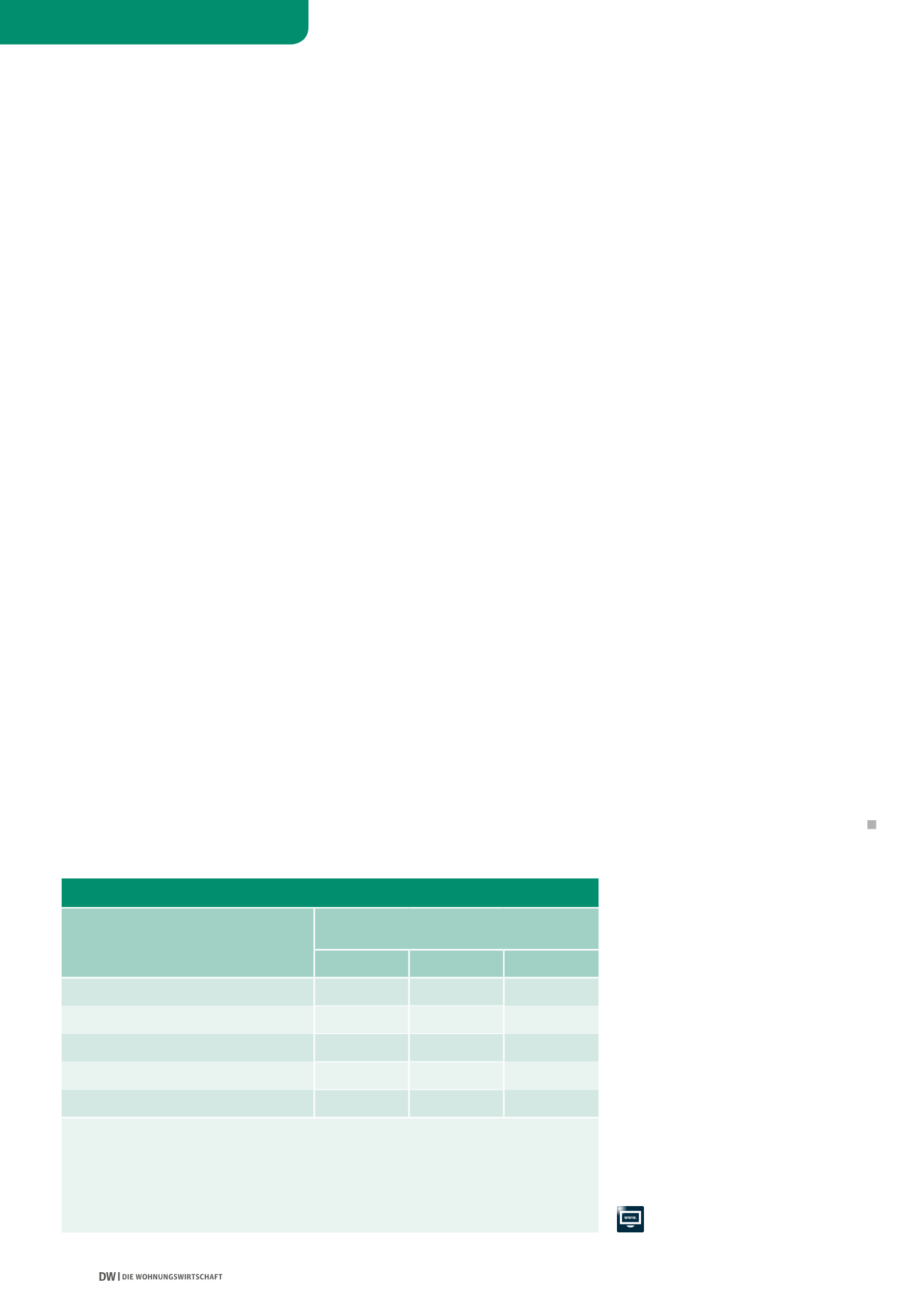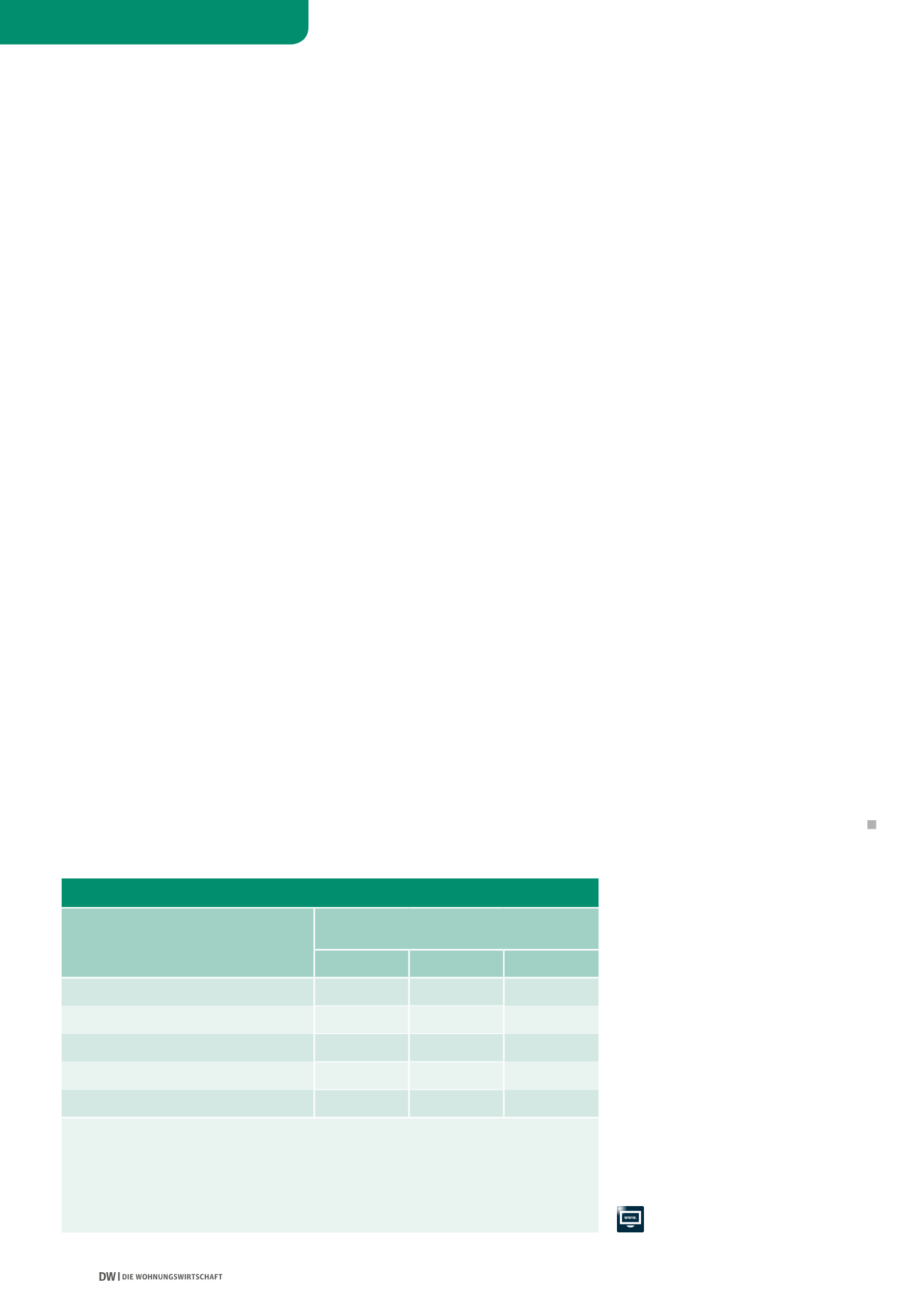
MARKT UND MANAGEMENT
58
3|2017
ist zu berücksichtigen, dass das Bewertungsziel
„gemeiner Wert“ und damit der „Verkehrswert“
aufgegeben werden soll. Neues Bewertungsziel
soll ein „Kostenwert“ sein, der nach der Begrün-
dung des Gesetzentwurfs den Investitionsaufwand
widerspiegelt.
Das ist grundsätzlich legitim und noch nachvoll-
ziehbar, inkonsistent ist dann allerdings, dass bei
der Ermittlung des Bodenwerts über die Boden-
richtwerte doch die Verkehrswerte einfließen; es
erfolgt keine Orientierung an den (ursprüngli-
chen) Anschaffungskosten und damit am Inves-
titionsaufwand des Grundstückeigentümers.
Bei der Ermittlung des Gebäudekostenwerts er-
folgt dagegen eine starke Typisierung der Pau-
schalherstellungskosten. Es sollen nur drei Bau-
altersklassen zur Anwendung kommen. Eine echte
wertmäßige Differenzierung – nach tatsächlichem
Investitionsaufwand – findet damit nicht statt.
Auchwird der Modernisierungsstand der Gebäude
nicht berücksichtigt, der mit Investitionen ver-
bunden ist. Die Pauschalherstellungskosten sollen
zum jeweiligen Hauptfeststellungszeitpunkt nach
Maßgabe der aktuellen Baupreisindizes angepasst
werden.
Das Absetzen einer Alterswertminderung und der
vorgegebene Mindestwert von 30% werden zur
Folge haben, dass z. B. alle (Wohn-)Gebäude, die
zum jeweiligen Hauptfeststellungszeitpunkt min-
destens 49 Jahre alt sind (wegen der unterstellten
Gesamtnutzungsdauer von 70 Jahren), mit dem
gleichen Gebäudekostenwert bewertet werden.
Werttreiber wird somit in den Ballungsräumen auf
jeden Fall der Bodenwert und damitwiederumeine
am Verkehrswert orientierte Komponente sein.
Begründet wird das Verfahren mit Gerech-
tigkeitsaspekten. Der Bürger würde ein nicht
wertorientiertes Verfahren (z. B. entsprechend
dem ursprünglichen Südländer-Modell, das am
Äquivalenzprinzip ausgerichtet war) nicht akzep-
tieren. Klar sollte allerdings sein, dass das jetzt
vorgelegte Modell auch nicht gerecht ist. Wenn
Gebäude mit dem gleichen Baujahr (z. B. Villa
und kleines Siedlungshaus) in der gleichen Ge-
meinde mit dem gleichen Kostenwert angesetzt
werden, ist das dem Bürger wohl auch schwer
vermittelbar.
Außerdem soll zur Ermittlung des Gebäudewerts
künftig auf die Brutto-Grundfläche eines Ge-
bäudes gemäß DIN abgestellt werden und nicht
mehr auf die Wohn- bzw. Nutzfläche. Die Brutto-
Grundfläche liegt – anders als die Wohn- bzw.
Nutzfläche – bei den Steuerpflichtigen häufig nicht
vor. Das bedeutet, die Datengrundlage „Brutto-
Grundfläche“ müsste aufwändig über Ingenieur-
büros bzw. amtlich bestellte Vermesser ermittelt
werden, was zu einem zusätzlichen Aufwand für
die Steuerpflichtigen führt. Hier haben die Länder
allerdings angekündigt, im Gesetz ein Umrech-
nungsverfahren anbieten zu wollen.
Nach Kenntnis über die Auswirkungen der Neube-
wertung der Grundstücke sollen in einemzweiten
Schritt die Grundsteuermesszahlen (neu) festge-
legt werden. Ziel soll eine bundesweite Aufkom-
mensneutralität der Reformder Grundsteuer sein.
Hierzuwird vorgeschlagen, den Ländern dieMög-
lichkeit zu eröffnen, jeweils eigene, landesweit
geltende Steuermesszahlen zu bestimmen. Der
Gesetzgeber denkt hier an ein Korrektiv für den
Fall einer künftigen Höherbewertung der Grund-
stücke. So ließe sich allerdings nur mit Blick auf
das landesbezogene Messbetragsvolumen in
gewisser Weise Aufkommensneutralität – nicht
Belastungsneutralität – herstellen. Solange den
Gemeinden das uneingeschränkte Recht zur Be-
stimmung des Hebesatzes zusteht, erscheint das
Korrektiv auf Landesebene aber nicht ausreichend.
Eine Aufkommensneutralität würde dann voraus-
setzen, dass auch die Gemeinden ihre Hebesätze
konsequent so anpassen, dass das Grundsteuer-
aufkommen gleichbleibt. Welche künftige Grund-
steuerbelastung die Steuerpflichtigen trifft, ist
daher völlig ungewiss.
Wie geht es weiter?
Der Bundesrat hat im November 2016 die Ein-
bringung der Gesetzentwürfe zur Reform der
Grundsteuer beim Deutschen Bundestag be-
schlossen.
1
Beide Gesetzentwürfe wurden der
Bundesregierung zur Stellungnahme zugeleitet.
Die Bundesregierung hat diese zwischenzeitlich
zur weiteren Beratung an den Deutschen Bundes-
tag überwiesen.
2
Die Bundesregierung unterstützt
das Ziel des Gesetzesvorhabens zur Änderung des
Bewertungsgesetzes, eine rechtssichere, zeitge-
mäße und verwaltungsökonomische Bemessungs-
grundlage für die Grundsteuer zu schaffen. Ob
dieses für den Bereich des Grundvermögens mit
dem vorgeschlagenen neuen Kostenwertverfah-
ren erreicht werden kann, bedarf allerdings noch
einer vertiefenden Prüfung. Eine Aussage zum
weiteren zeitlichen Ablauf des Gesetzgebungsver-
fahrens kann derzeit noch nicht getroffenwerden
– auch nicht dahingehend, ob in dieser Legislatur
überhaupt mit einer Einigung gerechnet werden
kann. Hinzu kommt die anstehende Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts
3
, die die vorge-
sehene Ausgestaltung der Neuregelung und den
Zeitplan des Inkrafttretens in Frage stellen könnte.
Der GdWwird auf der Grundlage des Gesetzesvor-
schlags Probeberechnungen vornehmen.
1
vgl. BR-Drs. 514/16 (B) und 515/16 (B) vom 4.11.2016.
2
vgl. BT-Drs. 18/10751 und 18/10753 vom 21.12.2016.
3
Az. des BVerfG: 1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15.
Weitere Informationen:
Neubau und Sanierung
Energie und Technik
Rechtssprechung
Haufe Gruppe
Markt undManagement
Stadtbauund Stadtentwicklung
PAUSCHALHERSTELLUNGSKOSTEN GEMÄSS ANLAGE 36 BEWG-E*
Gebäudeart
Pauschalherstellungskosten (PHK) in €/m
2
BGF
Baujahr
vor 1995 1995 – 2004
ab 2005
Mehrfamilienhäuser**
680
780
935
Gemischt genutzte Grundstücke***
675
860
1.085
Banken und ähnliche Geschäftshäuser
715
910
1.450
Bürogebäude, Verwaltungsgebäude
815
1.040
1.685
Wohnheime, Internate, Alten-, Pflegeheime
850
1.085
1.330
* Auszug, Stand Bundesrat-Drucksache 515/16 (B) vom 4.11.2016; PHK noch nicht auf den ersten Hauptfest-
stellungszeitpunkt 1.1.2022 indexiert.
** Mehrfamilienhäuser sind Gebäude, die zu mehr als 80 %, berechnet nach der Brutto-Grundfläche, Wohnzwecken
dienen, und nicht Ein- und Zweifamilienhäuser oder Wohnungseigentum sind.
*** Eine gemischte Nutzung liegt bei Gebäuden vor, die jeweils zu mindestens 20 %, berechnet nach der Brutto-
Grundfläche, Wohnzwecken und eigenen oder fremden betrieblichen oder öffentlichen Zwecken dienen und nicht
Ein- und Zweifamilienhäuser, Wohnungseigentum oder Teileigentum sind.
Quelle aller Grafiken: GdW