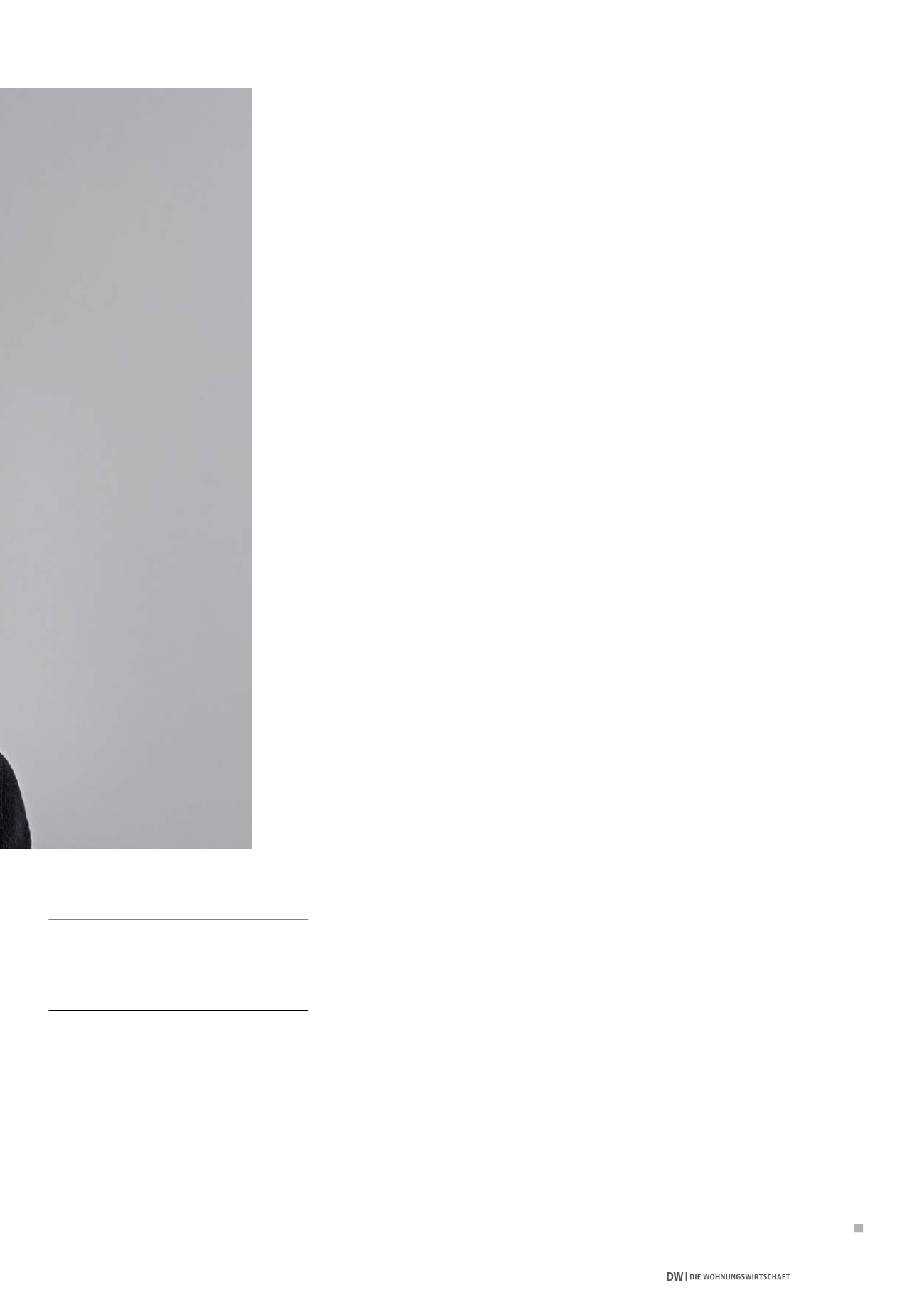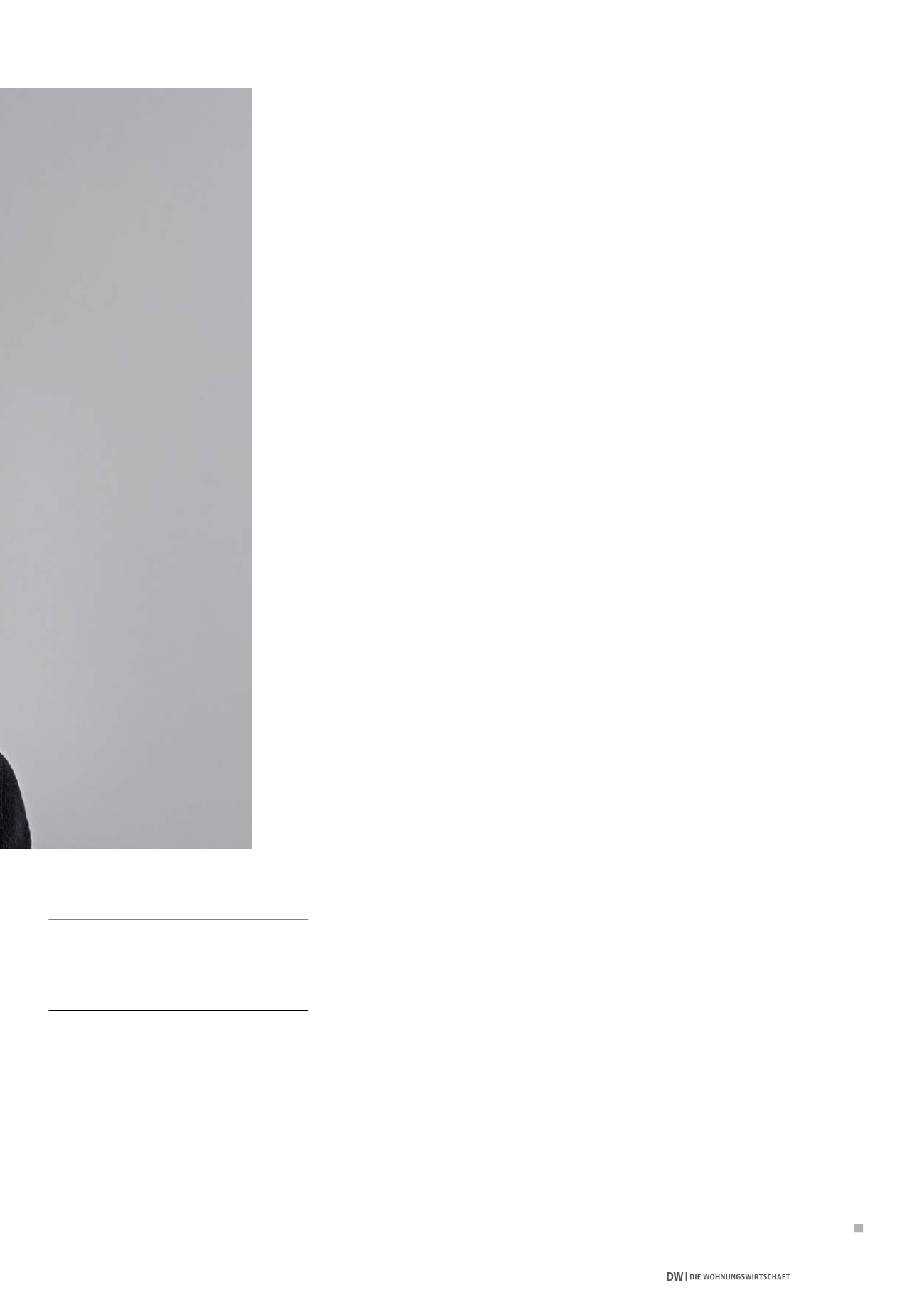
33
3|2017
Quelle: TÜV Süd
Feuchteschäden und Schimmelbildung in fast
dichten Wohngebäuden sind keine Seltenheit.
Experten diskutieren, wie und durch wen eine
ausreichende Lüftung sicherzustellen ist. Fol-
gende Fragen stehen dabei im Fokus: Welche
technischen Lösungen sind erforderlich? Wie
sollten diese dimensioniert sein? Lassen sie sich
mit konventionellem Fensterlüften kombinieren?
Welches Lüftungskonzept ist für Räume in Be-
tracht zu ziehen, in denen die Fenster aufgrund
ansätze kämen mit oft noch vertretbaren 6.000 €
aus. In der Praxis werden daher häufig Konzepte
mit Fensterlüftung oder aber mit Abluftanlagen,
angelehnt an bzw. nachDIN18017-3 „Lüftung von
Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster
mit Ventilatoren“, realisiert.
In vielen Fällen wäre ein Lüftungskonzept bes-
ser, das die Kombination aus kontrollierter Wohn-
raumlüftungmit manuellemFensterlüften zulässt.
Dieser wichtige Aspekt findet aber in DIN 1946-6
keine Berücksichtigung. Es fehlen Angaben darü-
ber, wie normales Fensterlüften – in Kombination
mit Lüftungsanlagen – in die vorgeschriebenen
Kalkulationen integriert werden kann. Die Norm
lässt hier keinen Spielraum: Bei Verwendung ei-
ner ventilatorgestützten Lüftung ist diese nach
Nennlüftung auszulegen. Eine Ergänzung durch
Fensterlüftung ist nicht vorgesehen.
Aus Sicht des TÜV Süd ist das Planen der Lüftung
nichts anderes als das Erstellen eines Lüftungs-
konzepts. Die Wohnraumlüftung sollte grund-
sätzlich im Einzelfall betrachtet und dann auch
so geplant werden. Wichtig ist, die bauphysika-
lischen Gegebenheiten und weitere ortstypische
Rahmenbedingungen im Blick zu haben. Für be-
stimmte Wohnungen oder einzelne Räume kann
ein Lüftungskonzept sogar alleine aus Fenster-
lüften bestehen. Für andere Gebäude oder ande-
re Rahmenbedingungen wäre eine Kombination
verschiedener lüftungstechnischer Maßnahmen
die beste Lösung. Bei Experten gilt die Norm
DIN 1946-6 aufgrund offener und teils auch
widersprüchlicher Passagen mindestens in ent-
scheidenden Teilen nicht als anerkannte Regel der
Technik. Daher sollte allenfalls in Anlehnung an die
Norm DIN 1946-6 geplant werden und z. B. der
DIN-Fachbericht 4108-8 Berücksichtigung finden.
Fazit und Leitlinie für die Zukunft
Bei jedem Neubau und jeder Modernisierungs-
maßnahme, die einen festgelegten Umfang über-
schreitet, ist ein Lüftungskonzept zu erstellen. Die
Empfehlung lautet daher, situationsbezogen und
bedarfsgerecht zu planen und dabei alle betei-
ligten Gewerke fachübergreifend einzubeziehen.
Die Erstellung eines Lüftungskonzepts kann in An-
lehnung an DIN 1946-6 erfolgen. Eine zu enge
Auslegung der Norm führt aber mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zu unverhältnismäßigen und nicht
wirtschaftlichen, in häufigen Fällenmindestens zu
energetisch schlechten Lösungen. Ein kritischer
Punkt ist die mögliche Überdimensionierung von
Lüftungssystemen. Begünstigt wird sie durch feh-
lende Angaben zur Kombination von normalem
Fensterlüften mit automatisierten Lüftungsan-
lagen. In der derzeit anstehenden Überarbeitung
der Norm wird dieser Punkt bereits diskutiert.
von Lärmbelastung nahezu immer geschlossen
bleiben müssen?
Die Ausgangslage: Energiebewusstes Bauen führt
zwangsläufig zu immer dichteren Gebäudehüllen.
Die Restinfiltration von Außenluft durch verblei-
bende, zulässige Leckagen kann so gering aus-
fallen, dass Schimmelbildung auftritt – sogar bei
mehrmaligem Fensterlüften pro Tag. Aber auch
Altbauten sind betroffen: Die Ursache können hier
neue und damit luftdichtere Fenster sein, die den
Lüftungsbedarf verändern. Dieser hängt von zahl-
reichen Faktoren ab. Dazu zählen die Luftwech-
selraten, die Beheizung und Feuchteerzeugung
(Nutzungsweise) sowie das Außenklima. Bei einer
ganzheitlichen Betrachtung sämtlicher Einfluss-
faktoren, bei der überprüft wird, welche Luft-
wechselraten bspw. erforderlich sind, sollte nur
auf den Einzelfall bezogen entschieden werden.
Norm verlangt nutzerunabhängige Lüftung
Die Lüftung zum Feuchteschutz ist nutzerunab-
hängig sicherzustellen – so legt es die DIN-Norm
1946-6 „Lüftung von Wohnungen“ fest. Zur Be-
gründung: Neubauten und modernisierte Wohn-
gebäude seien so luftdicht, dass ohne Verwendung
von technischen Lüftungssystemen sehr oft die
Fenster zu öffnen wären. Die Norm fordert eine
kontrollierteWohnraumlüftung – unabhängig von
der Anwesenheit der Bewohner und damit auch
unabhängig von manuellem Fensterlüften.
DIN 1946-6 schreibt den Nachweis eines Lüf-
tungskonzepts für Neubauten vor. Aber auch bei
Modernisierungen im Bestand kann die Norm zur
Anwendung kommen. Entscheidend ist hierbei
der Umfang der Sanierungen: Werden mehr als
ein Drittel der vorhandenen Fenster gegen neue
und damit luftdichtere Varianten ausgetauscht
bzw. wird mehr als ein Drittel der Dachfläche neu
abgedichtet, greift DIN 1946-6 ebenfalls. Die
Norm gibt verbindliche Berechnungsmethoden
zur Ermittlung der Luftwechselraten vor. Ohne
zusätzliche Maßnahmen wie Fensterlüfter und
Abluftventilatoren gelingt der Nachweis des er-
forderlichen Lüftungskonzeptes nur selten.
Wie praxistauglich ist das Regelwerk?
Im Mehrfamilienhausbau in Deutschland werden
nur selten Zu- und Abluftanlagen, vor allem mit
Wärmerückgewinnung, nachDIN1946-6 errichtet.
Das hat zwei wesentlicheUrsachen: Die in der Norm
geforderten Luftwechselraten sind imRegelfall hö-
her, als dies in der Praxis tatsächlich notwendig ist.
Und die zu veranschlagenden Kosten spielen eine
entscheidende Rolle. Denn pro Wohneinheit sind
bis zu 15.000 € Zusatzkosten für ein System mit
kontrollierterWohnraumlüftung inklusiveWärme-
rückgewinnung anzusetzen. Moderatere Lösungs-
Herbert Gottschalk
Leiter Bautechnik
TÜV Süd Industrie Service GmbH
München