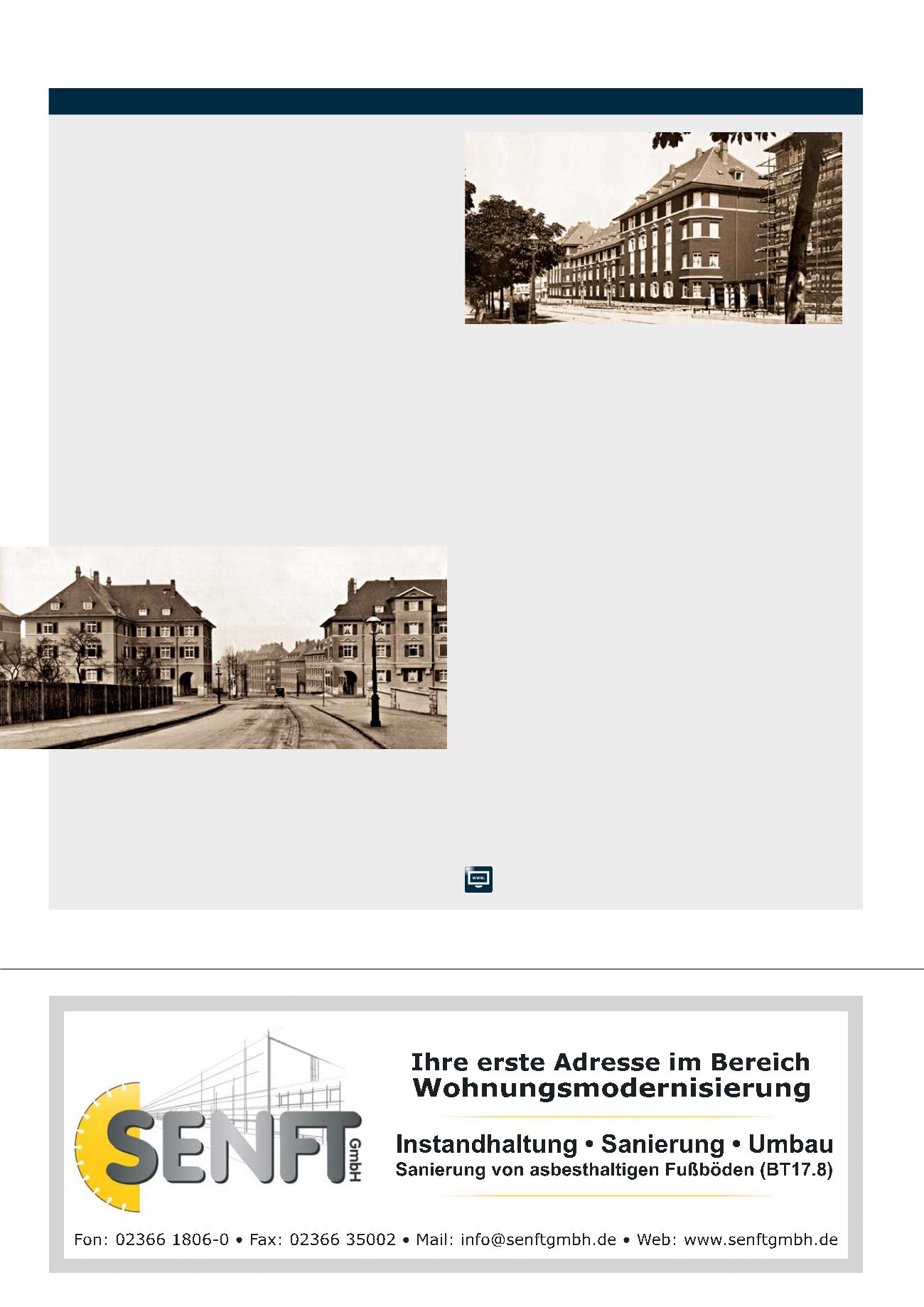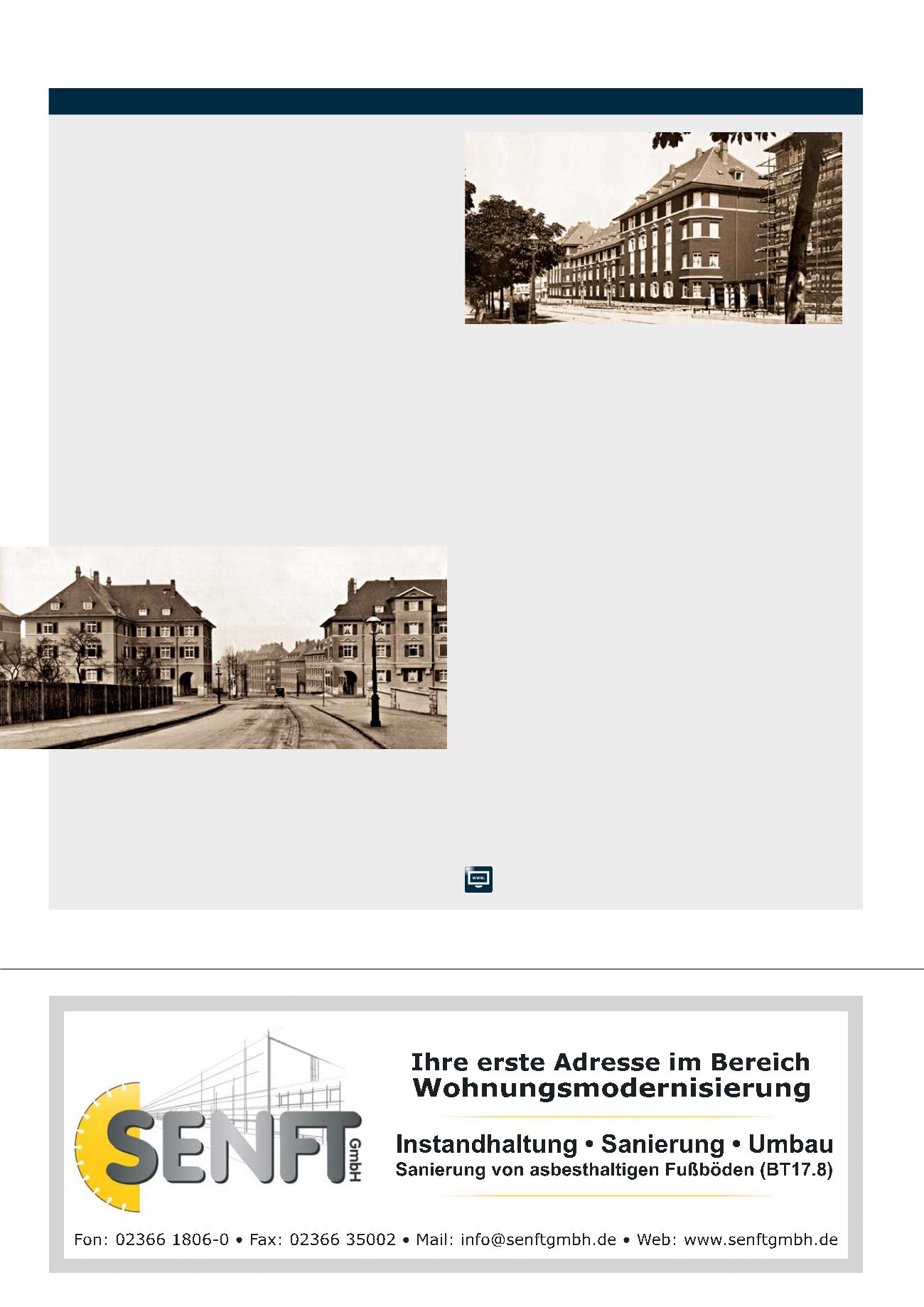
Darmstadt war schon Ende des 19. Jahrhunderts eine wachsende Stadt:
Seit Beginn der Industrialisierung zog es Zuwanderer aus der Umgebung
in die Residenzstadt. Allein im Martinsviertel wuchs die Bevölkerung zwi-
schen 1880 und 1910 von 1.630 auf 5.200 Haushalte an. Folge war eine
verstärkte Bautätigkeit, aus der auch die für weite Teile des Martinsvier-
tels noch heute typische Gründerzeitbebauung resultierte.
August Buxbaum
(1876-1960) schloss sein Architekturstudium an
der TU Darmstadt 1898 ab. Danach zog es ihn u. a. nach Berlin und
Nürnberg. 1904 kehrte der Architekt nach Darmstadt zurück und fand
Anstellung im Bauamt. 1906 wurde er zum Stadtbauinspektor ernannt,
1909 zum Stadtbaurat. Die bis 1930 in seiner Zeit als Baubeamter
entstandenen Gebäude – z. B. die Kyritzschule sowie etliche andere
Schulgebäude, das Darmstädter Stadtbad (heute das: Jugendstilbad),
sieben Kiosk-Häuschen auf verschiedenen Plätzen der Innenstadt sowie
die Wohnbebauung am Ostbahnhof – prägen das Darmstädter Stadtbild
bis heute. 1930 schied Buxbaum aus dem öffentlichen Dienst aus und
arbeitete anschließend als selbstständiger Architekt.
Das Gestaltungsprinzip der Anlage Rhön-/Spessartring am Rande des
Martinsviertels
ist besonders: Sind im unteren Teil des Rhönrings noch
eher schlichte dreigeschossige Bauten zu finden, so kombiniert sie Bux-
baum im weiteren Verlauf der Straße mit viergeschossigen Gebäuden, bei
denen er viel Sorgfalt auf einen dezenten – im öffentlichen Wohnungsbau
dieser Zeit äußerst untypischen – Fassadenschmuck verwendet. Er setzt
jedoch nicht nur vertikale und horizontale Zierleisten, Simse, Rosetten,
Fenstergiebel und Reliefskulpturen geschickt ein, um für Abwechslung
und Dynamik zu sorgen. Buxbaum nutzt auch die Anordnung der Fenster
als Gestaltungselement, baut hier und da Erker und Loggien, um die
Häuserzeilen zu gliedern und gegeneinander abzusetzen. Eine ungeheure
Gestaltungsvielfalt, die davon ablenkt, dass im Grunde immer wieder
dasselbe Gestaltungsprinzip variiert wurde.
Auffällig ist auch, dass bei vielen Blocks das zweite und dritte Geschoss
mit Hilfe zweier Simsleisten zu einer Einheit zusammengefasst wer-
den, während das vierte Geschoss optisch gestaucht und dadurch viel
niedriger wirkt. Sehenswert ist zudem der schöne, zum Teil allegorische
Reliefschmuck. So trägt die Verzierung des Rhönrings 38 beispielsweise
den Namen „Des Leides Abwehr“, die im Rhönring 50 den Namen „Das
Glück sich keinem Narren vertraut“.
Die
Mathildenhöhe
ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten
Darmstadts. Im 19. Jahrhundert befand sich hier bereits eine Gartenan-
lage des großherzoglichen Hofes, 1833 wurden die Gärten in einen Land-
schaftspark umgewandelt. Hierbei entstand auch der Platanenhain.1897
wurde die Russische Kapelle erbaut, ab 1899 erfolgte die Bebauung des
südlichen Teils durch die von Großherzog Ernst Ludwig im gleichen Jahr
gegründete Künstlerkolonie. 1906 bzw. 1908 folgten der von Joseph
Maria Olbrich entworfene Hochzeitsturm und das Ausstellungsgebäude.
Mit dem Jugendstilensemble, einem Mix aus experimenteller Architek-
tur, neuen Raumkonzepten und zukunftsweisendes Design, bewirbt sich
Darmstadt als UNESCO-Weltkulturerbe-Stätte.
BUXBAUM, DAS MARTINSVIERTEL & DIE MATHILDENHÖHE
Entrée zur Stadt: der Röhnring in den 1930er Jahren ...
Quelle der Schwarzweißfotos: Stadtarchiv Darmstadt
... und der Spessartring im Jahr 1929
Weitere Informationen:
Neubau und Sanierung
Energie und Technik
Rechtssprechung
Haufe Gruppe
Markt undManagement
Stadtbauund Stadtentwicklung