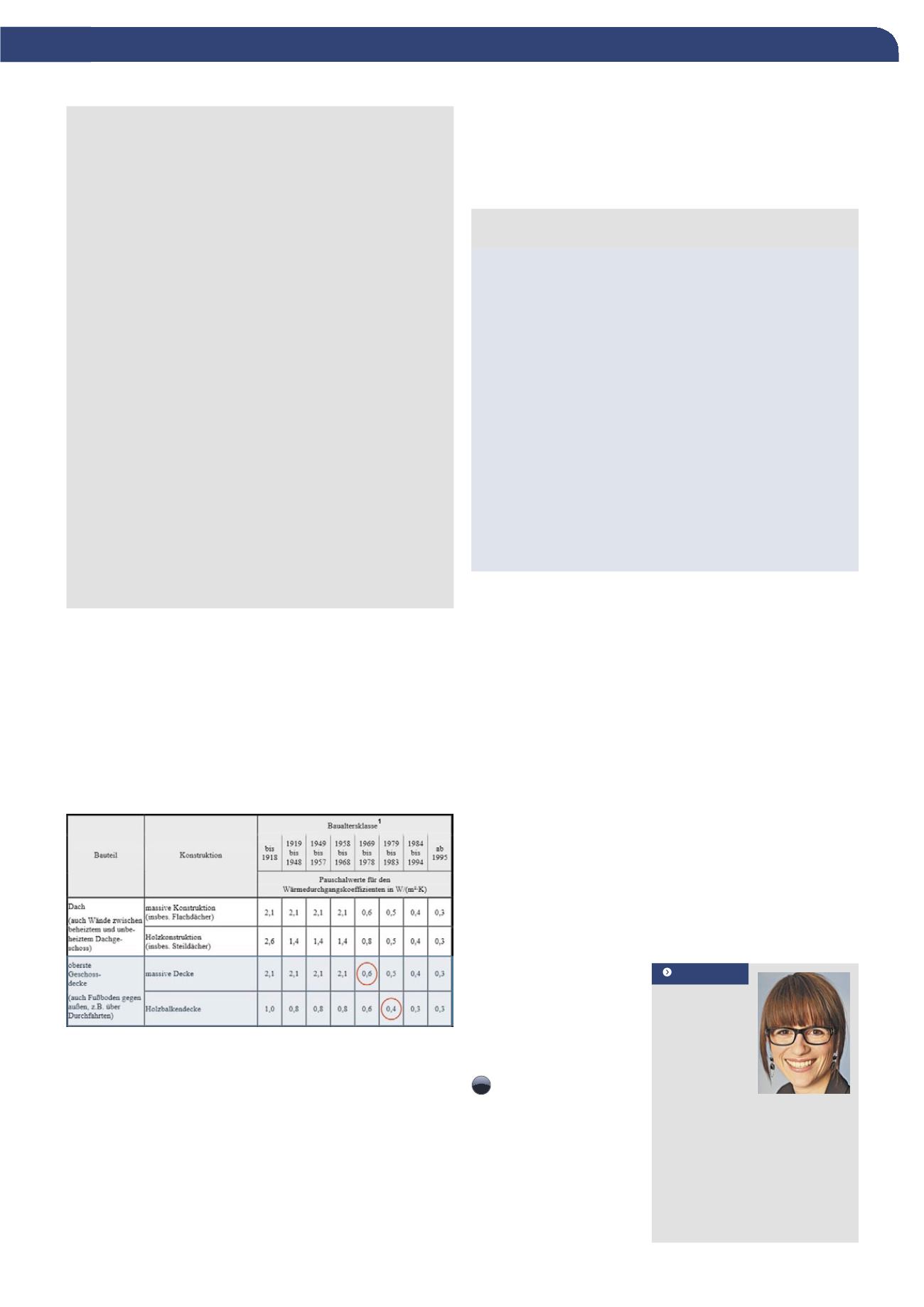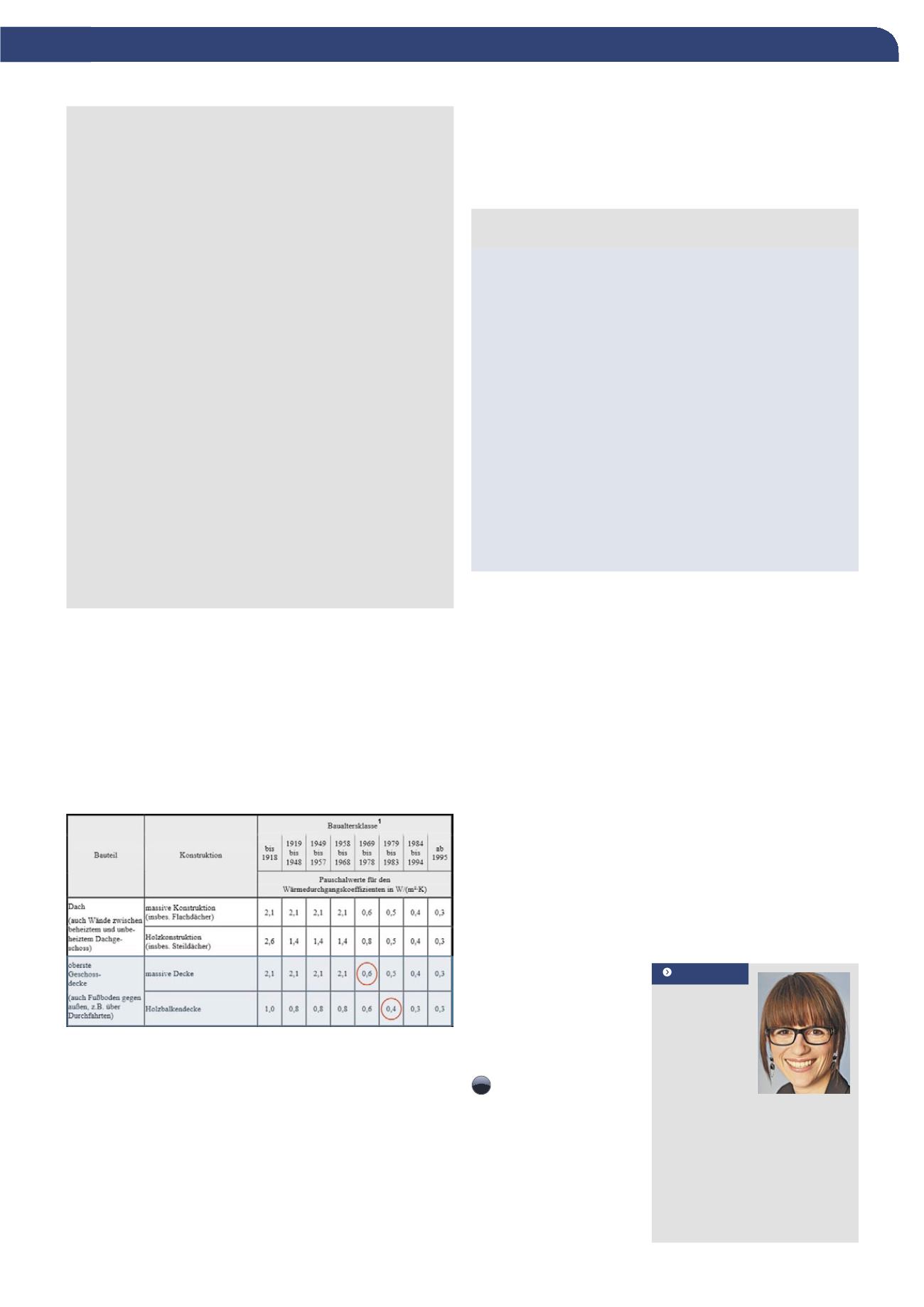
6. Ausnahmen
Wie bereits beschrieben, sind auch die Anforderungen an die Dämmung
der obersten Geschossdecke bei Wohngebäuden mit nicht mehr als 2 Woh-
nungen, von denen der Eigentümer eine Wohnung am 1. Februar 2002
selbst bewohnt hat, erst im Falle eines Eigentümerwechsels zu erfüllen.
7. Befreiungen und Bußgelder
Für die Dämmung der obersten Geschossdecke gelten die gleichen Befrei-
ungen und Bußgeldregelungen wie für den Austausch der Heizungsanlage
und die Dämmung der Warmwasser- und Wärmeverteilungsleitungen (vgl.
hierzu 1. Teil des Beitrags im Verwalterbrief, Ausgabe Februar 2015).
8. Berücksichtigung in der Praxis
Wie auch bei den Nachrüst- bzw. Austauschpflichten zur Heizungsanla-
ge und Dämmung der Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen
wird die Prüfung in der Praxis vor Ort erfahrungsgemäß nicht konse-
quent durchgeführt. Bei der Dämmung der obersten Geschossdecke
ist, anders als bei der Austauschverpflichtung der Heizungsanlage der
Bezirksschornsteinfeger, keine Person zur Prüfung und Vollzug des §
10 Abs. 3 EnEV benannt. In diesem Fall heißt das, dass nach § 26 EnEV
grundsätzlich der Bauherr verantwortlich ist, soweit in der EnEV nicht
ausdrücklich ein anderer Verantwortlicher benannt ist. Ebenso sind aber
auch Personen in ihrem Wirkungskreis verantwortlich, die im Auftrag
des Bauherrn bei der Errichtung oder Änderung von Gebäuden oder der
Anlagentechnik in Gebäuden tätig werden.
Ungeachtet der mangelnden
Kontrollpflicht vor Ort ist das
Wissen um die Anforderungen
des § 10 EnEV für Immobilie-
nexperten aus Haftungsgrün-
den unerlässlich.
!
Weiterführende
Informationen:
Workshops und Seminare zu
diesem Thema:
S-EWE – EnergieWert-Experte®
17.-20.03.2015 Sinzig
Weitere Seminare, Infos und
Anmeldung unter:
sprengnetter.de/seminarkalender
5. Hilfestellung von offizieller Seite
Das Deutsche Institut für Bautechnik, das in einem Fachkreis die Aus-
legungsfragen zur EnEV beantwortet, beruft sich in einigen Teilen u. a.
auf die „Bekanntmachung der Regeln zur Datenaufnahme und Daten-
verwendung im Wohngebäudebestand“ des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), heute veröffentlicht durch
das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Diese
Veröffentlichung kann ebenfalls helfen, den Aufbau der obersten Ge-
schossdecke einzuschätzen (vgl. Tab. 1).
Tab. 1: Auszug der „Bekanntmachung der Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im
Wohngebäudebestand“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)
Der Tabelle sind die deutschlandweit durchschnittlichen U-Werte ver-
schiedener Bauteile, unterteilt in Baujahresaltersklassen zu entnehmen.
Gemäß dieser Tabelle erfüllt das deutsche Durchschnittsgebäude ab
1969 mit einem U-Wert von 0,6 W/m²·K die Anforderungen an den
Mindestwärmeschutz. Da sich der Verordnungsgeber im § 10 Abs. 3
EnEV (Dämmung der obersten Geschossdecke) nicht auf diese Veröf-
fentlichung bezieht, kann die Tabelle nicht rechtssicher für eine Ein-
schätzung zugrunde gelegt werden. Der Einzelfall ist immer vor Ort zu
prüfen und individuell zu bestimmen.
7
Mindestwärmeschutz – EnEV 2014
Worin unterscheidet sich der Mindestwärmeschutz von den
Anforderungen der EnEV 2014?
Der Mindestwärmeschutz legt den Fokus auf einen wärmeschutz-
technischen Standard, der an jeder Stelle der Innenoberfläche der
wärmeübertragenden Umfassungsfläche ein hygienisches Raumkli-
ma sicherstellt. Vorausgesetzt ist eine ausreichende Beheizung und
Lüftung, sodass weder Tauwasser noch Schimmelpilze im Gebäude
an Außenwänden und Wärmebrücken, wie z. B. Zimmerecken, an-
fallen. Hier geht es also in erster Linie um eine funktionierende
Bauphysik und darum, Bauschäden an Gebäuden zu vermeiden.
Die EnEV hat den Zweck, Energie in Gebäuden einzusparen und
somit die energiepolitischen Ziele der Bundesregierung, bis 2050
einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand vorzuweisen, zu
erreichen. Der Verordnungsgeber formuliert in der EnEV höhere
Anforderungen, als sie für die reine Erfüllung des Mindestwärme-
schutzes erforderlich sind.
Beispiel Stahlbetondecke
Eine 15 cm starke, ungedämmte Stahlbetondecke, die zum beheiz-
ten Raum verputzt ist (Gipsputz), erreicht einen U-Wert von 2,23
W/m²·K. Sie erfüllt in dieser Bauweise nicht die Anforderungen an
den Mindestwärmeschutz, was u. a. Tauwasser- bzw. Kondensatbil-
dung an der Decke zur Folge haben wird.
Würden auf dieser Deckenkonstruktion (eine Dampfbremse und)
35 mm Dämmung (WLG 040) verlegt, wird ein U-Wert von 0,76
W/m²·K erreicht und der Mindestwärmschutz ist eingehalten. Das
Beispiel zeigt, dass bereits eine geringe Dämmstärke ausreicht, um
den Mindestwärmeschutz zu erfüllen – vorausgesetzt, die Dämmung
ist trocken und nicht (z. B. durch Begehungen) zusammengefallen/
-gedrückt.
Beispiel Holzbalkendecke
Die 2. Deckenvariante, der Abschluss eines beheizten Raumes ge-
gen einen Spitzboden oder Speicher, könnte gemäß Abbildung 3
schematisch konstruiert sein. Ist keine Dämmung vorhanden, wird
auch hier der Mindestwärmeschutz nicht eingehalten. Unterstellt
wird hierbei ein Aufbau mit innenseitiger Beplankung durch eine
Gipskartonplatte, einer Lattung, Dampfbremse, Holzbalken mit da-
zwischenstehender Luftschicht und darüberliegender Spanplatte.
Der U-Wert für diese Konstruktion beträgt 1,01 W/m²·K. Um die
Anforderungen des Mindestwärmeschutzes zu erreichen, ist eine
Dämmstärke (WLG 040) von 50 mm ausreichend, um den Mindest-
wärmeschutz zu erreichen.
Dipl.-Ing. (FH)
Kerstin
Nell
leitet in den
einzelnen Ge-
schäftszweigen
der
Spreng-
netter Immobilienbewertung den
Fachbereich Energie. Seit 2006 ist
sie als Referentin der Sprengnetter
Akademie im Bereich der Werter-
mittlung bebauter und unbebauter
Grundstücke sowie der Energie-
ausweiserstellung tätig.
DIE AUTORIN