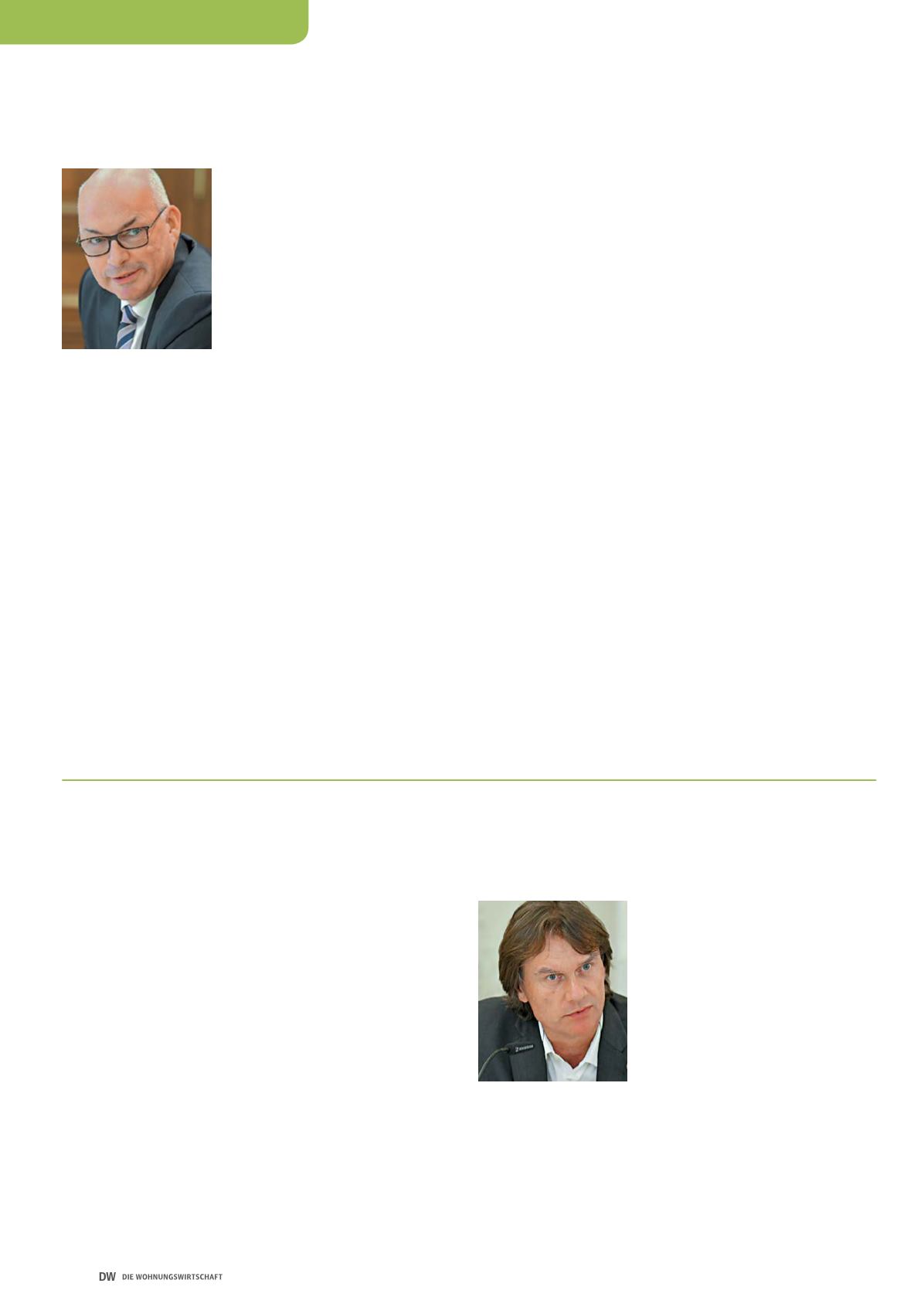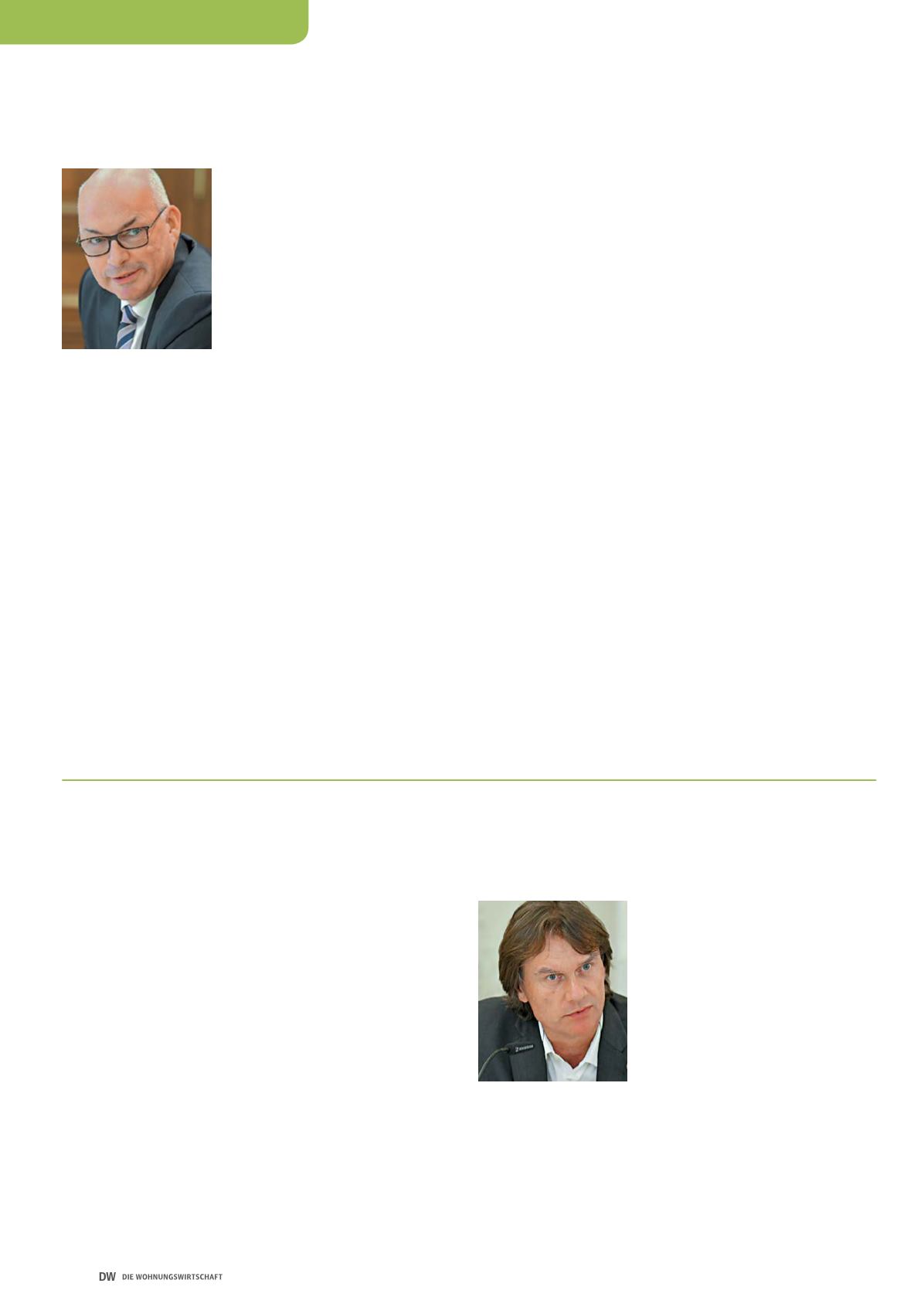
Ich komme aus einer Region, in der fast
jeder Zweite einen Migrationshintergrund
hat. Bei Vielen liegt dieser Migrationshin-
tergrund durch die Industrialisierung schon
sehr lange zurück, aber gerade nach Dort-
mund sind in den letzten Jahren auch viele
Menschen aus Rumänien und Bulgarien
gekommen. Das hängt damit zusammen,
dass viele ihren Angehörigen gefolgt sind,
die bereits früher nach Dortmund gegangen
sind. In einigen Wohngebieten wurden wir in unserer Stadt deshalb mit
den massiven Problemen von Matratzenvermietungen konfrontiert, später
stellte uns die sog. Flüchtlingswelle vor neue Herausforderungen.
Der Vorteil der Wohnungswirtschaft im Ruhrgebiet ist allerdings, dass
die kommunalen Gesellschafter i. d. R. nicht direkt in unser Geschäft
eingreifen und nicht verlangen, alle sozialen Problemfälle konzentriert
in unserem Bestand unterzubringen. Das gilt vor allem für Dortmund.
Denn unser Oberbürgermeister ist Raumplaner und hat Verständnis für
die Wohnungswirtschaft, die Zusammenarbeit und auch das Verständnis
der Verwaltung für unsere Aufgaben kann man als überdurchschnittlich
bezeichnen.
Wir haben ab 2003 durch Portfoliountersuchungen erkannt, dass einzelne
Objekte unseres Bestandes wohnungswirtschaftlich auf Dauer nachhal-
tig nicht zu halten waren. Aber es gibt diese Häuser immer noch. Andere
Marktteilnehmer haben sie übernommen und im Zuge der sog. Flücht-
lingskrise auf eine Art und Weise vermietet, die dazu geführt hat, dass die
Eigentümer viel Geld verdient, aber gleichzeitig die Nachbarschaft massiv
belastet haben. Dies führte zu großen Problemen – und das in einer Stadt,
in der jeder zweite Haushalt Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein
hat, in der die Zahl der Sozialwohnungen seit dem Jahr 2000 um 80%
zurückgegangen ist.
Wir haben als kommunales Unternehmen hingegen unsere Wohnungen
modernisiert, sodass sie jetzt – für die regionalen Verhältnisse – relativ
teuer sind (unsere Durchschnittsmiete liegt bei 5,80 €/m
2
monatlich).
Damit ist es manchmal für Transferleistungsempfänger schwierig, sich mit
Wohnraum zu versorgen. I. d. R. landen diese Menschen dann eben auch in
den Häusern, die wir verkauft haben.
Gleichwohl gibt es auch bei uns Probleme. Ein großes Problem war, dass im
Rahmen der Flüchtlingskrise eine Reihe von jungen Menschen, die merk-
würdigerweise alle zum selben Zeitpunkt 18 Jahre alt wurden, auf der
Wohnungssuche unsere Sprechstunden stürmten – sie hatten bei der Ein-
reise ein falsches Alter angegeben und mussten die Einrichtungen für junge
Menschen verlassen. Um die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleis-
ten, haben wir einen Sicherheitsdienst beauftragt, ein Sicherheitskonzept
umgesetzt und in Zusammenarbeit mit der Polizei ein Deeskalationstrai-
ning durchgeführt. Auf diese Weise ist es uns gelungen, das Problem in den
Griff zu bekommen und eine relative Ruhe zu erreichen.
Grundsätzlich bin ich aber der Ansicht, dass wir als kommunales Unter-
nehmen nicht die Aufgabe haben, alle sozialen Probleme in unseren
Beständen zu lösen. Unser Handeln muss mit einer Gewinnerzielungs-
absicht verbunden sein, bei der wir auch die wirtschaftlichen Risiken zu
tragen haben.
Wir müssen Geld verdienen. Dieses Geld nimmt der Gesellschafter ja gern
an, wenn es darum geht, den städtischen Haushalt zu entlasten und dafür
zu sorgen, dass es einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr gibt
und das Gemeinwesen am Laufen zu halten.
Klaus Graniki, Geschäftsführer, DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH, Dortmund
Es ist nicht unsere Aufgabe, die sozialen Probleme zu lösen
Der Begriff der überforderten Nachbarschaften impliziert, dass die Hilfe
von außen kommen muss. Wenn man überfordert ist, kann man ja nicht
selber die Lösung herbeiführen. Das aber ist ein Grundproblem der gesam-
ten Diskussion. Wenn nämlich den Betroffenen immer wieder eingeredet
wird, sie seien überfordert, dann delegieren sie die Verantwortung für das
Problem reflexhaft an andere Stellen. Das wiederum führt im Extremfall
zu einer Konkurrenz unter Bedarfsgruppen, zu einer Entsolidarisierung der
Gesellschaft und im schlimmeren Fall zu einer Radikalisierung.
Es liegt also der Denkfehler vor, dass man die betroffene Gruppe von der
Verantwortung freistellt. Diese kann sich dann abwartend zurücklehnen
und warten, bis Hilfe von außen kommt. Im Falle der Nachbarschaft bie-
tet sich dafür das Wohnungsunternehmen an. Das, so die vorherrschende
Ansicht, sind ja die Fachleute dafür.
Ein objektiver Tatbestand, den ich niemandem anlasten möchte, ist die
zunehmende Veränderungsgeschwindigkeit. Ich lese gerade das neue Buch
von Frank Schätzing („Die Tyrannei des Schmetterlings“), das sich mit
künstlicher Intelligenz befasst. Wenn man sich näher mit diesem Thema
auseinandersetzt, dann merkt man, dass
das keine Science Fiction ist, sondern dass
schon jetzt Veränderungen im Gange sind,
die ich persönlich nicht mehr verstehe. Und
die meisten anderen werden sie genauso
wenig verstehen wie ich. Gerade bei Men-
schen, die nicht die Möglichkeit haben, dank
einer gefestigten sozialen Struktur und
einer guten Ausbildung Stabilität zu finden,
kann ich mir gut vorstellen, dass diese Ver-
unsicherung die Entwicklung hin zu prekären Verhältnissen in der Nachbar-
schaft beschleunigt.
Wir tun uns – in der Wohnungswirtschaft und in der Politik – nicht immer
einen Gefallen bei den Lösungsvorschlägen. Ich bin der viel gelobten
Objektförderung gegenüber etwas kritisch eingestellt. Denn wir erzeugen
dadurch Siedlungen, die eine sehr homogene Mieterstruktur aufweisen.
Zudem haben wir eine hohe Fehlbelegung, weil Menschen, die gar nicht
Ingo Malter, Geschäftsführer, Stadt und Land Wohnbauten-Gesellschaft mbH, Berlin
Die Objektförderung gehört auf den Prüfstand
STÄDTEBAU UND STADTENTWICKLUNG
12
12|2018