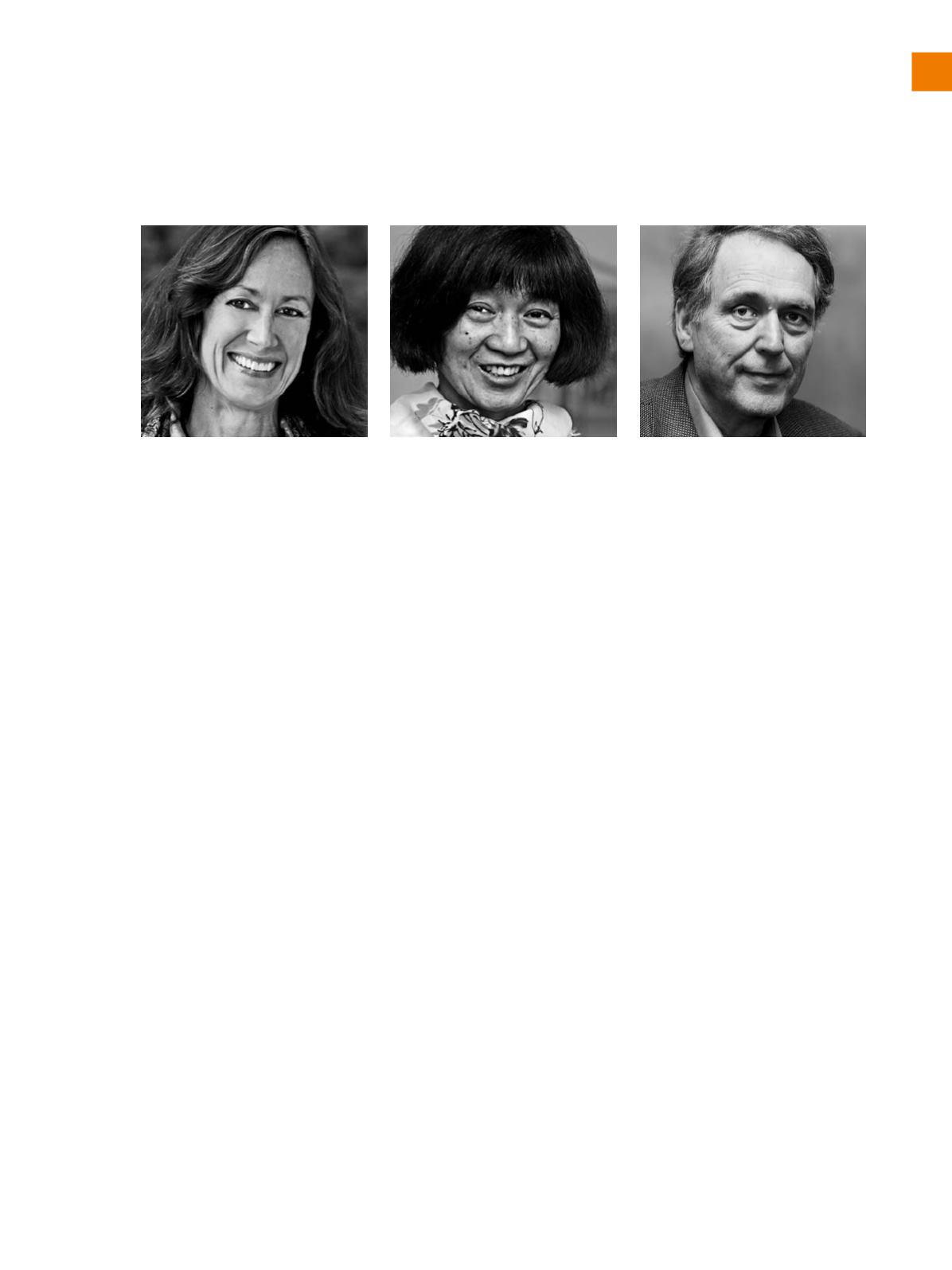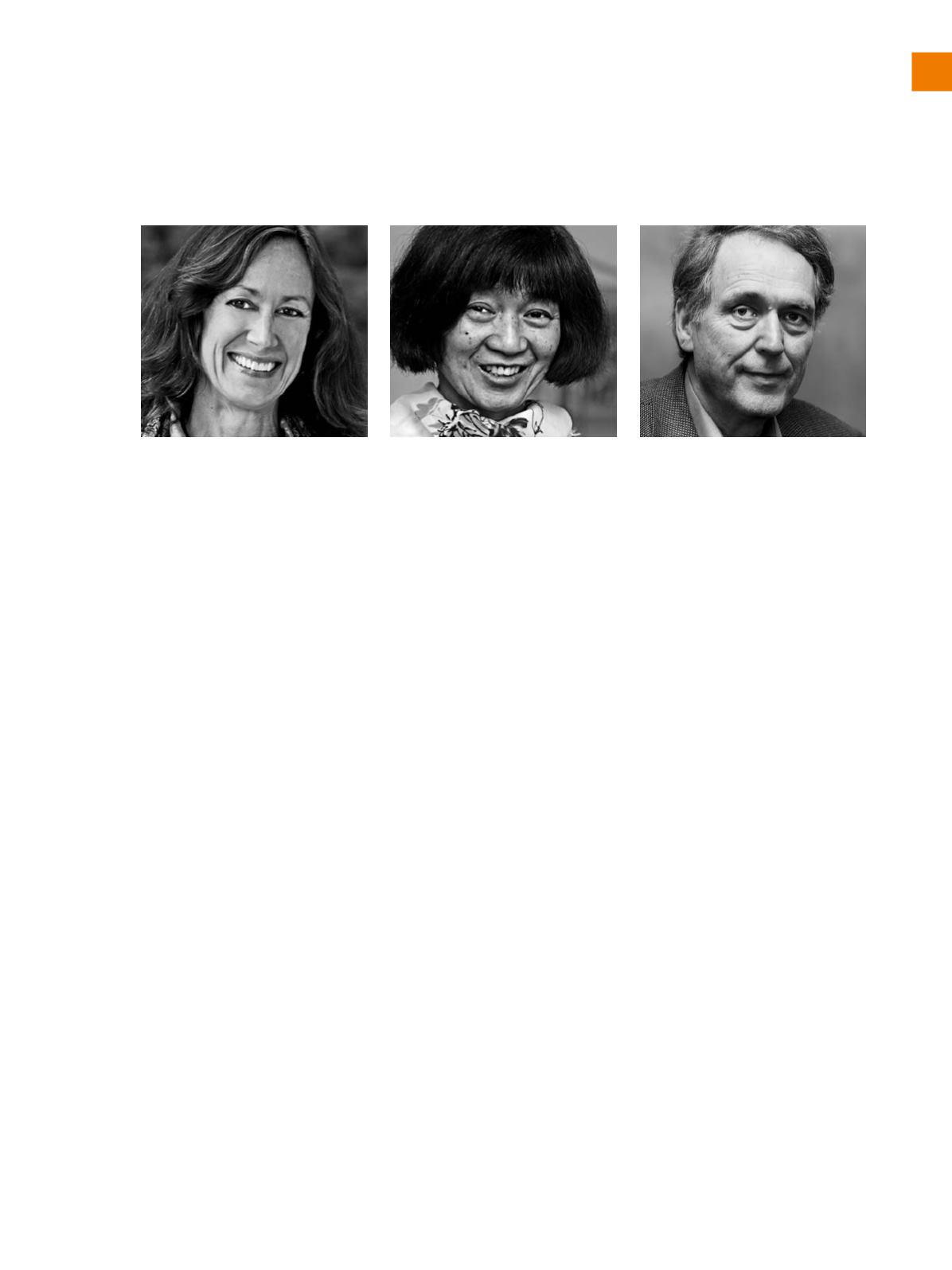
04/15 PERSONALquarterly
65
sagt Schölmerich, der aber auch betont, dass „der familiäre
Einfluss bei kognitiver Stimulation durch Bücher wie durch
elterliche Zuwendung sehr stark“ sei.
Immer wieder wird – vom Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW) in Berlin, vom Institut der Deutschen
Wirtschaft Köln (IW) oder auch von der Bertelsmann-Stiftung
in Gütersloh und der Vodafone Stiftung in Düsseldorf – die in
Deutschland besonders starke Verankerung in den sozialen
Schichten erforscht und beschrieben. Hier einige Ergebnisse:
Nach einer DIW-Studie, 2013 veröffentlicht nach der Disser-
tation von Juniorprofessor Daniel Schnitzlein, hängt etwa der
Bildungserfolg zu 55 Prozent vom Elternhaus ab, individuelle
Arbeitseinkommen könnten zu 40 Prozent mit der Familien-
herkunft erklärt werden; nach einer Erhebung des Studenten-
werks kommen auch Anfang 2014 von 100 Akademikerkindern
75 Prozent auf der Hochschule an, von 100 Arbeiterkindern
nur ein Viertel; das IW wiederum hat sich 2012 mit Allein
erziehenden beschäftigt und zieht den Schluss, dass der Kin-
dergartenbesuch einen erheblichen positiven Effekt auf die
Kompetenzentwicklung der Ein-Eltern-Kinder hat und der Be-
such von Ganztagsschulen ebenso fördernd wirkt. Basis sind
beim IW die Kompetenztests von Pisa 2009.
Lage der Arbeitszeiten entscheidend
Eine kritische Überprüfung von internationalen Studien zum
Thema Wochenend-, Abend- und Nachtarbeit des Wissen-
schaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) ist 2014
im Journal of Primary Prevention erschienen. Die Sozialwis-
senschaftlerin Jianghong Li untersuchte mit einem Team 23
internationale Analysen aus den vergangenen 30 Jahren unter
der Fragestellung, inwieweit Arbeitszeiten, die über die Nor-
malarbeitszeit hinausgehen, wie etwa Schicht-, Abend-, Nacht-
und Wochenendarbeit, sich negativ auf das Wohlergehen von
Kindern auswirken. In 21 der 23 Studien fand Forscherin Li
V. l. n. r.: Prof. Kathleen McGinn (Harvard Business School), Jianghong Li Ph. D. (WZB), Prof. Dr. Axel Schölmerich (Ruhr-Universität
Bochum)
deutlich negative Auswirkungen: Verhaltensauffälligkeiten
waren häufiger und kognitive Leistungen wie Sprechen, Lesen
und Rechnen schlechter. Außerdem hatten Kinder von Eltern
mit atypischen Arbeitszeiten häufiger ein höheres Gewicht als
Kinder von Eltern, die überwiegend in der Normalarbeitszeit
ihrem Job nachgingen.
Gesundheit von Kindern erforschen
Jianghong Li nennt eine Reihe von Ursachen für diese Befunde:
„Die Erziehungsaufgaben können schlechter wahrgenommen
werden, weil sich die Nähe zwischen Eltern und Kindern ver-
ringert und der Austausch zwischen Müttern und Vätern auf
der einen Seite und dem Nachwuchs auf der anderen Seite
schwächer wird.“ Besonders betroffen sind Kinder aus Fami-
lien mit nur einem Elternteil, ärmere Familien und solche, in
denen die Eltern Vollzeit nachts und amWochenende arbeiten.
Die WZB-Forscherin fordert mehr Unterstützung der Eltern in
den Familien und am Arbeitsplatz: „Die Familien müssen in
den Unternehmen durch Angebote für Kinderbetreuung und
flexiblere Arbeitszeiten unterstützt werden. Wichtig ist es, dass
Väter mehr Aufgaben in der Familie übernehmen können.“
Sozialwissenschaftlerin Li geht der Frage jetzt weiter nach,
wie die Folgen der 24/7-Gesellschaft, die Dienstleistungen rund
um die Uhr erfordert, abgefedert und die Bedingungen für die
Kinder verbessert werden können. Sie und ihre WZB-Kollegen
Matthias Pollmann-Schult und Till Kaiser analysieren derzeit
die repräsentativen Längsschnittdaten aus dem sozio-ökono-
mischen Panel (SOEP) und dem Pairfam (Panel Analysis of
Intimate Relationships and Family Dynamics) in Deutschland,
um die Folgen der Abend-, Nacht-, undWochenendarbeit für die
Eltern und für die Gesundheit und Entwicklung ihrer Kinder
zu erforschen. Gefördert wird das Projekt von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG). Ein wichtiger Aspekt für die
Arbeitswelt der Zukunft und ihre Auswirkungen auf Familien.
© WZB
© RUB, FOTO: NELLE
© HBS