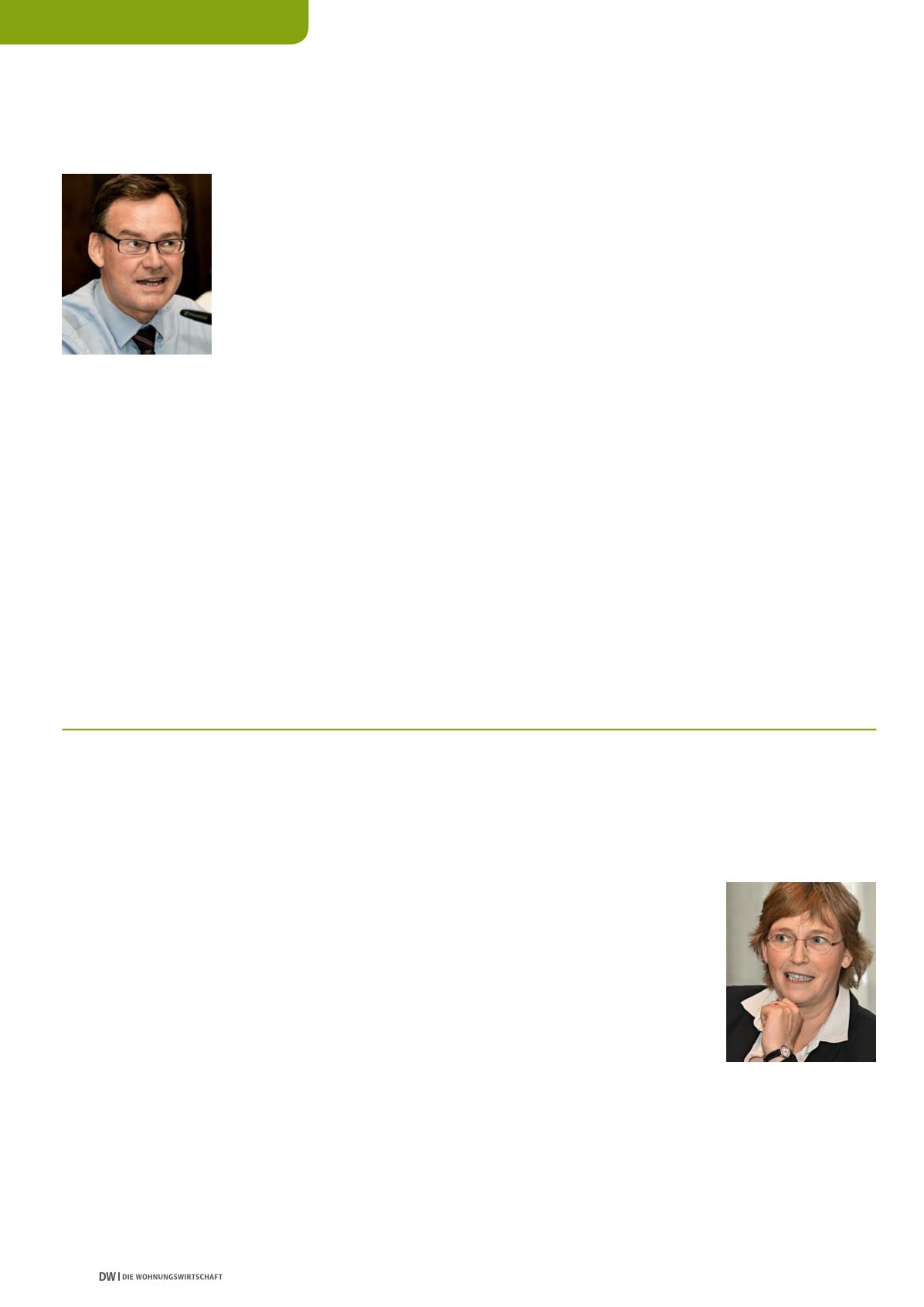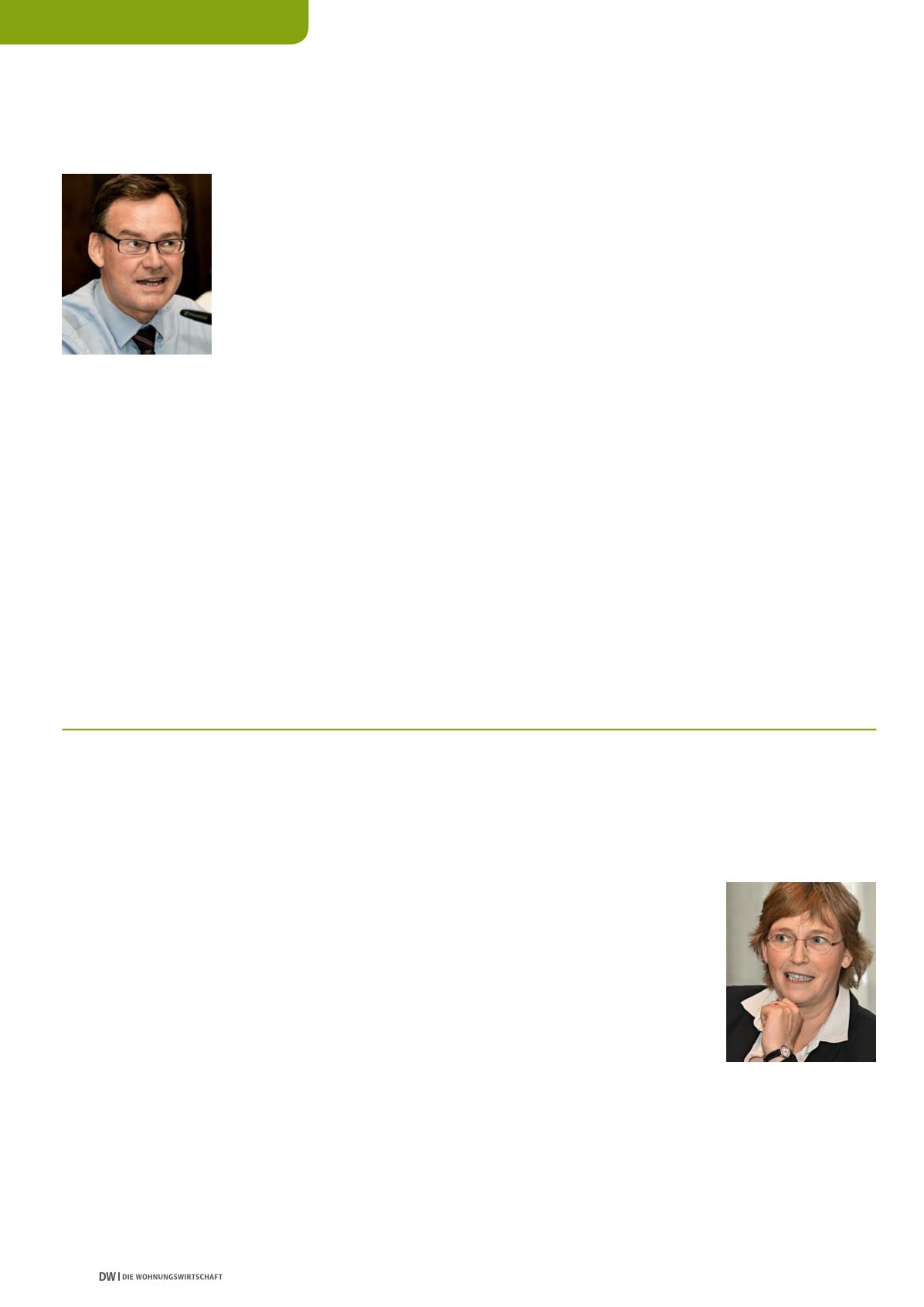
Zunächst eine Vorbemerkung: Bei der
kommunalen Wohnungsbaugesellschaft in
Dortmund ist der Leerstand auf weniger als
1% gesunken. In vielen anderen Städten in
Nordrhein-Westfalen sieht es ähnlich aus.
Das zeigt: Wir stehen vor dem Problem,
Wohnungen zu finden in einem Markt, auf
dem eigentlich keine freien Wohnungen
mehr zur Verfügung stehen.
Die erste Frage unserer heutigen Diskussion
zielt auf die Bezahlbarkeit. Dabei müssen wir feststellen, dass wir ein Stück
weit neben unserem klassischen Marktsegment bauen, weil wir häufig gar
nicht anders bauen können als zu teuer. Die Mieten, die wir verlangen
müssen, kann sich unsere Klientel eigentlich nicht leisten. Ein Grund dafür
liegt darin, dass sich die technische Ausrüstung der Gebäude insbesondere
aufgrund von Vorgaben des Bundesgesetzgebers dramatisch verändert
hat. Der zweite Grund liegt imMangel an Bauland, der die Preise nach oben
treibt. Und drittens fehlt es an Behördenmitarbeitern, die dieses Bauland
planerisch zur Verfügung stellen und Baugenehmigungen erteilen.
Die nächste Frage: Wo und wie viele Wohnungen müssen wir bauen? Die
überraschende Antwort lautet, dass wir nicht nur in den Hotspots Woh-
nungen errichten müssen, sondern auch dort, wo wir einen Wohnungs-
überschuss haben. Denn auch dort brauchen wir ein Angebot für diejenigen
Menschen, die attraktiveren Wohnraum suchen, an dem es an diesen Orten
oft mangelt. Was die Zahl betrifft, so spricht selbst der etwas zurückhal-
tende Bundesstatistiker jetzt von jährlich mind. 350.000 Wohneinheiten.
Unserer Ansicht nach müssen es sogar 400.000 sein, davon 80.000 Sozial-
wohnungen und mind. 60.000 weitere bezahlbare Wohnungen.
Erfreulicherweise haben die GdW-Unternehmen im vergangenen Jahr
17.400 Wohneinheiten gebaut und damit 18% mehr als 2014. Allerdings
zeigt diese Zahl auch, dass wir die Aufgabe nicht alleine werden bewältigen
können. Die spannende Frage ist, wie man diejenigen Akteure einbinden
kann, die früher im Neubau tätig waren. Das waren z. B. Unternehmen, die
Wohnungen für ihre Mitarbeiter gebaut haben, und Handwerker, die ein
Mietshaus zur Altersvorsorge errichtet haben. Um private Investoren zu
gewinnen, braucht es weitergehende Anreizinstrumente, über die wir in
der anschließenden Diskussion sicher nachdenken werden.
Schließlich zur Finanzierung: Unser Wohnungsbau-Tag hat gezeigt, dass
es möglich wäre, die Miete ohne Förderung um 2 bis 3 €/m
2
zu senken.
Wenn es dem Staat aber nicht gelingt, die dafür nötigen Voraussetzungen
zu schaffen, dann müssen wir über die soziale Wohnraumförderung reden.
Dafür stellt der Bund jetzt 1 Mrd. € pro Jahr zur Verfügung, und weitere
500 Mio. € sind „in der Pipeline”. Wenn die Länder das eins zu eins gegenfi-
nanzieren würden, stünden 3 Mrd. € zur Verfügung. Das ist nicht schlecht.
Allerdings haben viele Länder in der Vergangenheit diese Gelder nicht so
ausgegeben, dass sie wirklich als Anreiz für den Neubau gedient haben.
Zinsverbilligungen wirken ja nur begrenzt. Außerdem ist die Finanzierung
durch den Bund nur bis 2019 gesichert. Es lohnt sich die Überlegung, ob
man danach nicht wieder zu einer Gemeinschaftsaufgabe zwischen Bund
und Ländern kommen sollte. Der Bund würde dann weiter Geld zur Ver-
fügung stellen, könnte aber auch Einfluss darauf nehmen, dass die Länder
dieses Geld tatsächlich für die Förderung des Wohnungsbaus ausgeben.
Axel Gedaschko, Präsident, GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V., Berlin
Wir können gar nicht anders bauen als zu teuer
Wer den Wohnungsmarkt schon so lange beobachtet wie einige hier am
Tisch, der weiß, dass es immer Zyklen gibt und dass die Reaktion immer
zu spät und immer übertrieben kommt. In genau einer solchen Situation
befinden wir uns jetzt wieder. Wir müssen auf dem Wohnungsmarkt zwar
reagieren, aber wir sollten nicht überreagieren. Deshalb sollten wir die Zah-
len genau betrachten.
Das betrifft auch die nötigen Neubauzahlen. Meiner Ansicht nach brauchen
wir nicht, wie es Herr Gedaschko fordert, 400.000 Wohnungen pro Jahr,
sondern allenfalls 300.000. Die Zahlen aktueller Prognosen müssen sehr kri-
tisch hinterfragt werden. Das BBSR ist z. B. von einem enorm hohen Bedarf
an Ein- und Zweifamilienhäusern ausgegangen. In Wirklichkeit sind deut-
lich weniger gebaut worden, und trotzdem findet sich gerade im ländlichen
Raum ein ausreichendes Angebot. Umgekehrt sind deutlich mehr Geschoss-
wohnungen gebaut worden, als das BBSR prognostiziert hat.
Genauer hingucken muss man auch deshalb, weil die Nachfrage längst nicht
überall so hoch ist wie in Köln, Düsseldorf und Hamburg. In Wuppertal z. B.
– nur eine halbe Stunde von Köln entfernt und hervorragend an den Nahver-
kehr angebunden – findet man auf jeden Fall eine Wohnung. Das Gleiche gilt
für Frankfurt (Oder), das sehr gut an Berlin
angebunden ist.
Hinzu kommt eine grundlegende Verände-
rung. Seit 1990 hat sich die Haushaltsgröße
in Deutschland um 10% verkleinert, während
sich die Wohnfläche um 20% vergrößert hat.
Vor allem ältere Menschen haben eine große
Wohnfläche; Personen über 60 beanspruchen
durchschnittlich 60 m
2
pro Kopf. Zwar ver-
sucht die Wohnungswirtschaft seit langem,
mit Umzugshilfen die Menschen dazu zu
bewegen, aus ihrer zu groß gewordenen Wohnung auszuziehen. Um dabei
erfolgreich zu sein, bräuchte es aber die Hilfe des Staates. Denn unser Miet-
recht bevorzugt denjenigen, der lange in einer Wohnung bleibt, so dass nach
dem Umzug in eine kleinere Wohnung die Miete in der Regel höher ist als in
der vorherigen größeren Wohnung. Das wirkt natürlich nicht motivierend.
Wir müssen zudem aufpassen, dass die Attraktivität von Standorten nicht
noch stärker auseinanderfällt als bisher. Auch in einer Stadt wie Frankfurt
Bettina Harms-Goldt, Geschäftsführerin, Analyse & Konzepte Beratungsgesellschaft für Wohnen, Immobilien,
Stadtentwicklung mbH, Hamburg
Wir sollten nicht überreagieren
24
10|2016
NEUBAU UND SANIERUNG