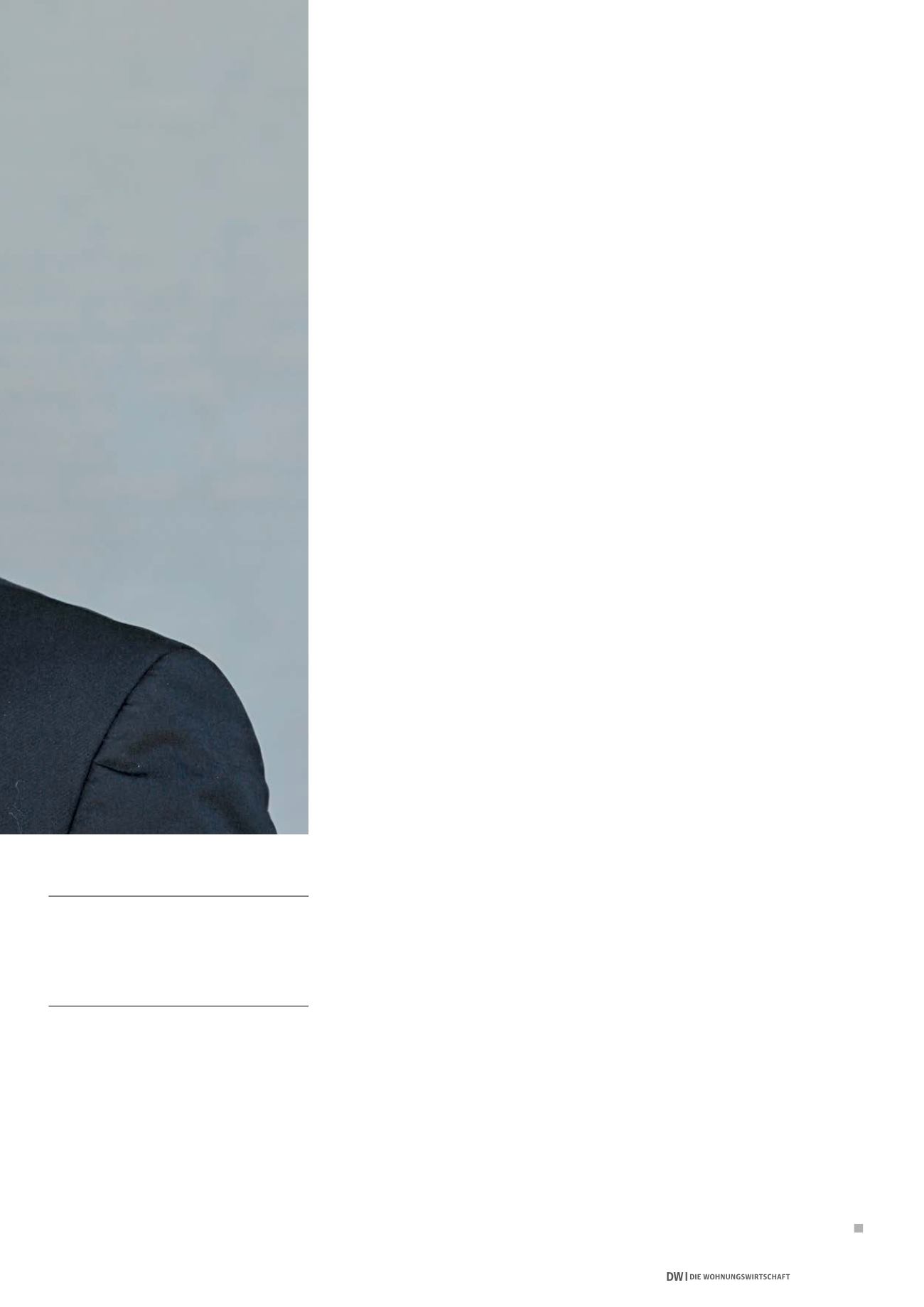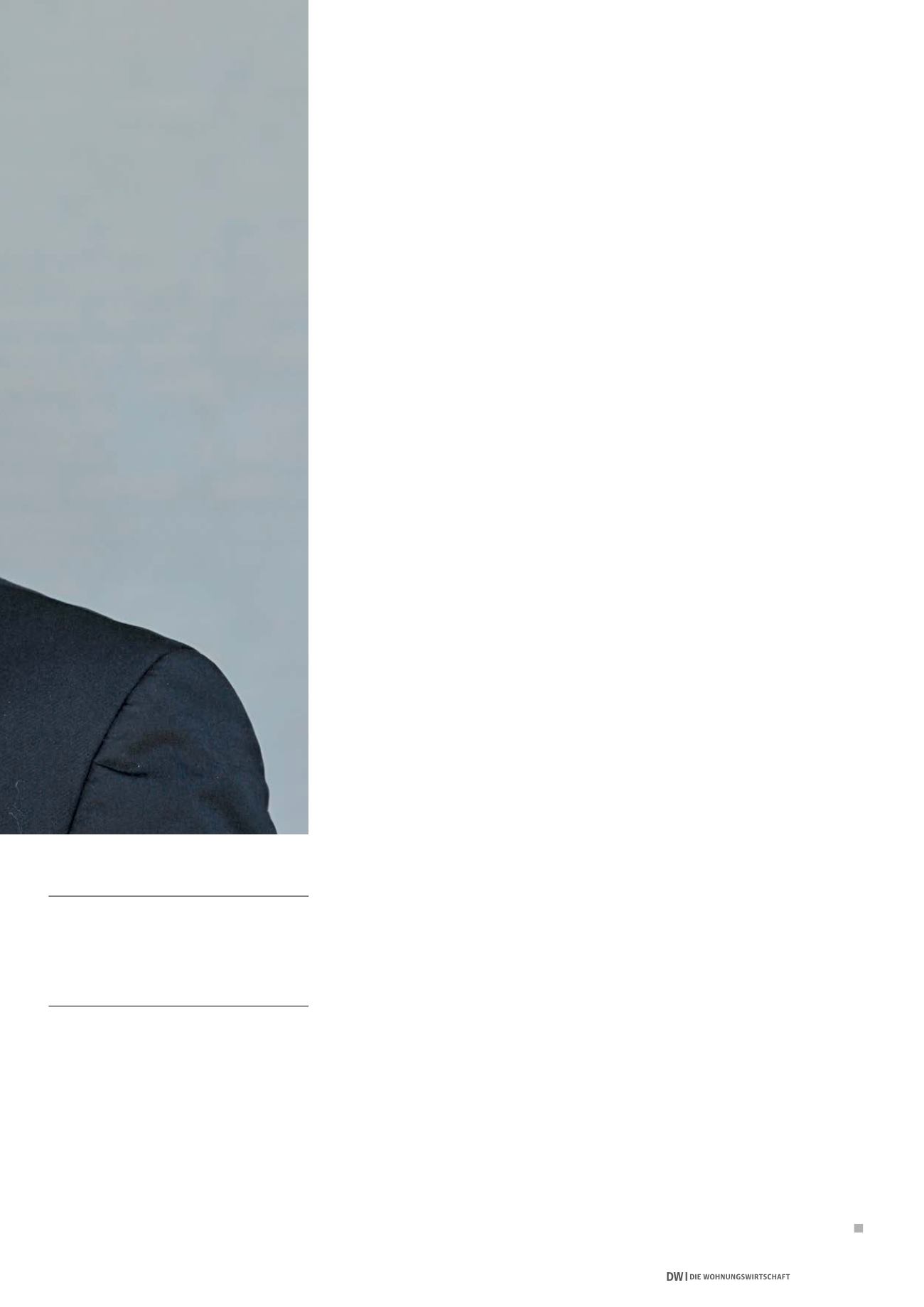
9
12|2015
Der öffentliche Raum prägt die Identität einer
Stadt. Er gibt ihr – auchwenn sie groß und unüber-
schaubar erscheint – einenmenschlichenMaßstab.
Öffentliche Räume werden vielseitig genutzt: für
Märkte und Muße, Sport und Mobilität, Demonst-
rationen, Feste und Darbietungen, Kommunikati-
on, Kunst und Konsum. Von der Qualität öffentli-
cher Räume profitiert die Öffentlichkeit einer Stadt
unmittelbar – Flanieren und Einkaufen genauso
wie alltägliche Wege und Begegnungen stehen im
unmittelbaren Zusammenhang mit der Schönheit
öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Öffentliche
und öffentlich zugängliche Gassen, Straßen, Bou-
levards, Promenaden, Passagen, Höfe, Anger und
Plätze bilden in der Stadt ein vielfältiges, dichtes
Netz. Das einzelne Element bekommt seinenWert
durch seine stadträumliche Lage und Funktion im
Netz, durch denGrad der Verknüpfungmit anderen
Elementen. Durch seine Gestaltung vermittelt und
fördert der öffentliche Raumein spezifisches Ver-
halten. Für seine Gestaltung und die grundlegen-
den Spielregeln seiner Nutzung ist in erster Linie
die Kommunalpolitik verantwortlich. Oder muss
es heißen, „war” sie verantwortlich?
Privatisierung öffentlicher Räume
Aufgrund klammer kommunaler Kassen entstehen
zunehmend mehr „private” öffentliche Räume.
Shoppingcenter und Malls haben es vorgemacht
– großräumige Entwicklungen mit Aufenthalts-
räumen und Freiflächen als Surrogat öffentlicher
Räume. Bei aller Freude der Städte über den ver-
meintlich kostengünstigen, privat geschaffenen
öffentlichen Raum muss festgehalten werden:
Diese Flächen unterliegen i. d. R. einer Hausord-
nung und festgeschriebenen Öffnungszeiten. Sie
sind letzlich privat und nicht öffentlich. Hier kommt
es entscheidend auf dieAusgestaltung der Verträge
mit den Trägern dieser Vorhaben an:WelcheMate-
rialien findenVerwendung, wie sindÖffnungs- und
Durchgangszeiten organisiert, wie wird das Haus-
recht ausgeübt? Eigentümerstandortgemeinschaf-
ten und Business Improvement Districts machen
es nach, die Privatisierung öffentlichen Raums
schreitet fort. Bei aller Entlastung der öffentlichen
Haushalte durch dieses Instrument: Es bleibt ent-
scheidend, dass dieUmgestaltung des öffentlichen
Raums ein gesellschaftlich „inklusives“ Konzept
verfolgt, niemanden von der Nutzung ausgrenzt
und die Nutzerbelange der allgemeinen Öffent-
lichkeit und nicht in erster Linie die merkantilen
Belange der Anrainer berücksichtigt.
Die Gesellschaft nimmt die Privatisierung öffent-
licher Räume durchaus wahr und fordert ihre Zu-
gänglichkeit undNutzungsoffenheit für jedermann
ein. Neben angepassten Steuerungsoptionen führt
derWeg daher auch über eine bessere Einbeziehung
von Öffentlichkeit bzw. Nutzern des öffentlichen
Raums. Viele zivilgesellschaftliche Akteure brin-
gen sich in die Gestaltung und Entwicklung der
öffentlichen Räume ein. Allerdings kann sich die
Wirkung bürgerschaftlichen Engagements auch ins
Gegenteil verkehren und ähnlich nachteilige Effek-
te nach sich ziehenwie die Privatisierung. Die Inbe-
sitznahme öffentlicher Flächen durch Abgrenzun-
gen (Gated Communities), „exklusive“ Begrünung
(GuerillaGardening) oder Zwischennutzungen, die
nur einembegrenztenNutzerkreis zugänglich sind,
sind ebensowenig imSinne einer offenenNutzung
wie die zuvor angesprochene Privatisierung.
Königsweg
Es stellt sich die Frage: Gibt es einen „Königsweg“
zwischen der Verantwortung für den öffentlichen
Raum bei gleichzeitig unterfinanzierten Kommu-
nalhaushalten und den merkantilen Interessen
der Projektentwickler, Eigentümer und Gewerbe-
mietern sowie dem Engagement und der Erwar-
tungshaltung der Öffentlichkeit für ihr Quartier,
ihr Stadteilzentrum oder ihre Stadtmitte? Diesen
Königsweg, der sich in der Praxiswohl eher alsMit-
telweg auftut, gibt es: Nur bedarf es hierfür einer
verbesserten Steuerungswirkung der Städte.
Wirtschaftlich starke Städte können aufgrund des
Nachfragedrucks freie, nicht überdachte Passa-
gen und Durchwegungen von Baublöcken ohne
Öffnungszeiten durchsetzen. Dies muss künftig
verstärkt auch für nachfrageschwächere Standor-
temöglich sein. Projektentwicklungenmüssen ein
maßgeschneidertes Konzept zur Einbeziehung der
Öffentlichkeit liefern, umNutzungsanforderungen
und -konkurrenzen identifizieren und beheben zu
können. Insgesamt bedarf es einer intensiveren
Kommunikation aller Beteiligten in der sog. Pla-
nungsphaseNull, der Programmierung von Projek-
ten, die Auswirkungen auf den öffentlichen Raum
haben oder auf seine Qualität angewiesen sind.
Diskursiver, partizipativer Prozess
Hierbei gilt es auch, eine Verständigung darüber zu
erreichen, wie dieÖffentlichkeit inPlanung undGe-
staltung der öffentlichen Räume einbezogen wer-
den soll: durch Information, Mitwirkung, Teilhabe
oder eigeneGestaltungsvorschläge und -ideen, die
Eingang in eine Entwurfs- undAusführungsplanung
finden? Das erfordert eine Verständigung darüber,
dass es keineswegs eine Korrelation zwischen der
Gestaltungsqualität öffentlicher Räume und dem
Grad der Einbeziehung der Öffentlichkeit gibt.
Allerdings gibt es genauso wenig einen Automa-
tismus, dass die gestalterische Qualität mit dem
Grad der Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem
Ergebnis einhergehen muss.
DieAnforderung an Städte, Finanzierer undNutzer:
Der öffentliche Raummuss in diskursiven, partizi-
pativen Prozessen gestaltetwerden. Das Ziel sollte
gleichermaßen der gestalterische Gewinn und die
Nutzungsqualität für Anrainer und Öffentlichkeit
sein. So können aus gemeinschaftlich gestalteten
öffentlichen Räumen tatsächlich Chancen für die
Weiterentwicklung der Stadt bzw. des Quartiers
entstehen – für alle Beteiligten und Betroffenen,
und ohne den öffentlichen Raum für eine merkan-
tile Optimierung preisgeben zu müssen.
Hilmar von Lojewski
Beigeordneter
Leiter des Dezernats Stadtentwicklung, Bauen,
Wohnen und Verkehr
Deutscher Städtetag
Berlin
Quelle: Deutscher Städtetag, Foto: David Ausserhofer